Abmahnwelle durch KI-generierte Inhalte


Juristische Expertise
- Cybercrime & Krypto-Betrug
- AI & Zukunftsrecht
- Steuerrecht & Steuerstrafrecht
- Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht & Zivilrecht
- Datenschutz & Digitalrecht
Abmahnwelle durch KI-generierte Inhalte – Verteidigung und Gegendarstellung
KI-generierte Texte, Bilder oder Musikstücke sorgen jüngst vermehrt für Abmahnungen. Erfahren Sie, warum diese Inhalte rechtlich umstritten sind, wie Rechteinhaber vorgehen und mit welchen Strategien Sie sich erfolgreich gegen Abmahnungen wehren können. KI-Tools eröffnen enorme kreative Potenziale, aber man sollte sich der rechtlichen Spielregeln bewusst sein. Eine frühzeitige anwaltliche Prüfung von kritischen Inhalten und die Implementierung klarer Compliance-Maßnahmen können Abmahnungen oft im Keim ersticken. Panik ist nicht angebracht – wer die Rechte Dritter respektiert und im Ernstfall sachgerecht reagiert, kann die meisten Abmahnungen entschärfen. Die Verteidigung gegen unberechtigte oder überzogene Abmahnungen lohnt sich insbesondere dann, wenn die Rechtsgrundlage der Abmahnung zweifelhaft ist.
Ausgangslage – Warum KI-Inhalte abgemahnt werden
KI-generierte Inhalte wie Texte, Bilder, Musik oder sogar imitierten Stil anderer Künstler bewegen sich oft in urheberrechtlichen Grauzonen. In letzter Zeit häufen sich Fälle, in denen Rechteinhaber oder spezialisierte Agenturen Abmahnungen aussprechen, um vermeintliche Verstöße zu ahnden. Typische Fehler, die zu Abmahnungen führen, sind unter anderem:
- Fehlende Rechteprüfung: Oft werden Quellen und Urheberrechte der eingespeisten Daten nicht sorgfältig geprüft. Dadurch kann es passieren, dass geschützte Vorlagen oder Texte unwissentlich von der KI reproduziert werden.
- Geschützte Begriffe und Marken: Die Nutzung geschützter Markenbegriffe oder urheberrechtlich geschützter Werke ohne Genehmigung kann sofort eine Abmahnung nach sich ziehen. Selbst alltägliche Begriffe können markenrechtlich geschützt sein – wer KI-Outputs ungeprüft veröffentlicht, läuft Gefahr, Markenrechte zu verletzen.
Rechtliche Bewertung – Urheberrecht, UWG, Markenrecht
Die rechtliche Einordnung KI-generierter Inhalte ist komplex und berührt verschiedene Gesetze:
- Urheberrecht: Grundsätzlich genießt ein rein von KI geschaffenes Werk keinen Urheberrechtsschutz, da es an einer menschlichen Schöpfungshöhe fehlt. Allerdings können KI-Werke als Bearbeitungen oder Plagiate gelten, wenn sie wesentliche geschützte Elemente menschlicher Vorlagen enthalten. In solchen Fällen greift § 23 UrhG: Eine Bearbeitung fremder Werke bedarf der Zustimmung des Originalurhebers. Schutzfähig ist ein KI-Ergebnis nur, wenn ein menschlicher kreativer Beitrag eindeutig überwiegt (§ 2 Abs. 2 UrhG). Mit anderen Worten: Je mehr eigenständige Entscheidungen die KI trifft, desto weniger wahrscheinlich ist Urheberrechtsschutz am Output – und desto eher droht eine Urheberrechtsverletzung des ursprünglichen Werkes.
- Wettbewerbsrecht (UWG): Auch das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb spielt eine Rolle. Werden KI-generierte Inhalte verwendet, die etwa aufgrund fehlender Kennzeichnung oder Nachahmung geeignet sind, Verbraucher zu täuschen, kann eine Irreführung oder unlautere Nachahmung nach § 4 UWG vorliegen. Konkurrenten könnten dann auf Unterlassung klagen oder abmahnen.
- Markenrecht: Die Verwendung fremder Markennamen oder Logos in KI-generierten Texten und Bildern ist riskant. Markeninhaber können Unterlassung und Schadensersatz fordern, wenn ihre Marke im geschäftlichen Kontext unerlaubt genutzt wird. Eine Abmahnung im Markenrecht erfordert allerdings, dass tatsächlich eine Verwechslungsgefahr oder Ausnutzung der Marke vorliegt.
- Haftung von Plattformen: Spannend ist auch die Frage, inwieweit Plattformbetreiber (z. B. KI-Tools oder Content-Plattformen) haften. Nach aktueller Rechtslage können Betreiber haftbar gemacht werden, wenn sie zumutbare Prüfungs- und Überwachungsmaßnahmen missachten. Insbesondere nach den §§ 7 ff. TMG (Telemediengesetz) gilt ein Plattformbetreiber haftungsrechtlich als Mitstörer, wenn er von Rechtsverletzungen weiß und nichts unternimmt, um diese zu verhindern.

Verteidigung gegen Abmahnungen
Wenn eine Abmahnung wegen KI-Inhalten ins Haus flattert, heißt es: Ruhe bewahren und systematisch vorgehen. Wichtige Verteidigungsstrategien sind:
- Prüfung der Anspruchsgrundlagen: Zunächst sollte geprüft werden, ob die Abmahnung inhaltlich berechtigt ist. Liegt tatsächlich eine Urheberrechtsverletzung oder Markenrechtsverletzung vor? Ist der Abmahner überhaupt zur Forderung berechtigt? Häufig finden sich in Abmahnschreiben pauschale Vorwürfe, die einer genauen rechtlichen Überprüfung nicht standhalten.
- Unterlassungserklärung mit Bedacht: Abmahner fordern meist die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung. Diese sollte keinesfalls ungeprüft unterschrieben werden. Stattdessen empfiehlt sich oft eine modifizierte Unterlassungserklärung, die das Eingeständnis auf das Nötigste begrenzt und unverhältnismäßige Vertragsstrafen vermeidet. Damit kann man das Kostenrisiko senken, ohne gleich alle Forderungen anzuerkennen.
- Gegendarstellung und Verhandlung: Eine schriftliche Gegendarstellung an den Abmahner kann helfen, die eigene Rechtsposition darzulegen. In vielen Fällen lassen sich durch sachliche Kommunikation überzogene Forderungen reduzieren oder ein Vergleich erzielen. Wichtig ist, klare Argumente zu liefern – etwa, dass ein vermeintlich kopierter Inhalt doch eigenständig genug ist oder dass sofort reagiert und der Inhalt entfernt wurde. Gegebenenfalls sollte ein spezialisierter Anwalt die Kommunikation übernehmen, um auf Augenhöhe zu verhandeln.
Prävention und Compliance
Am besten ist es natürlich, Abmahnungen gar nicht erst entstehen zu lassen. Unternehmen und Kreative, die KI einsetzen, sollten daher präventive Maßnahmen und interne Richtlinien etablieren:
- Interne KI-Guidelines: Legen Sie firmenweite Richtlinien fest, welche KI-Tools wofür eingesetzt werden dürfen und welche Inhalte tabu sind. Beispielsweise kann geregelt werden, dass keine Prompts eingegeben werden, die geschütztes Material erzeugen könnten (z. B. „Schreibe einen Text im Stil von [bekannter Autor]“ ohne dessen Erlaubnis).
- „Human in the Loop“: Stellen Sie sicher, dass immer eine menschliche Endkontrolle erfolgt. Dieser Nachweis menschlicher Kontrolle – etwa durch ein Vier-Augen-Prinzip bei Veröffentlichung KI-erstellter Inhalte – kann das Risiko erheblich reduzieren. Menschen können erkennen, ob die KI eventuell geschütztes Material reproduziert oder Persönlichkeitsrechte verletzt.
- Dokumentation der Prompts und Quellen: Jeder KI-Einsatz sollte dokumentiert werden. Welche Daten wurden zum Training genutzt? Welcher Prompt wurde eingegeben und welcher Output kam heraus? Eine lückenlose Dokumentation der Prompt- und Quellenkette ist im Ernstfall Gold wert. So kann im Streitfall gezeigt werden, dass man sorgfältig gearbeitet hat und die KI nicht bewusst zur Rechtsverletzung eingesetzt wurde.
- Datenschutz beachten: Neben Urheber- und Markenrecht dürfen auch datenschutzrechtliche Vorgaben nicht vernachlässigt werden. Werden personenbezogene Daten durch KI verarbeitet oder für Trainingszwecke genutzt, können bei Missachtung der DSGVO ebenfalls Abmahnungen oder Bußgelder drohen. Achten Sie also darauf, dass KI-Systeme keine vertraulichen Kundendaten unerlaubt verwenden – mehr dazu in unserem Beitrag „Datentraining mit Kundendaten – Wann droht ein DSGVO-Schaden?“.

Fazit – Rechtssicherheit statt Panik
KI-Tools eröffnen enorme kreative Potenziale, aber man sollte sich der rechtlichen Spielregeln bewusst sein. Eine frühzeitige anwaltliche Prüfung von kritischen Inhalten und die Implementierung klarer Compliance-Maßnahmen können Abmahnungen oft im Keim ersticken. Panik ist nicht angebracht – wer die Rechte Dritter respektiert und im Ernstfall sachgerecht reagiert, kann die meisten Abmahnungen entschärfen. Die Verteidigung gegen unberechtigte oder überzogene Abmahnungen lohnt sich insbesondere dann, wenn die Rechtsgrundlage der Abmahnung zweifelhaft ist.
Für eine ganzheitliche Rechtssicherheit beim KI-Einsatz lohnt der Blick über den Tellerrand: In weiteren Beiträgen dieser Serie beleuchten wir vertragliche Haftungsfragen bei KI-Projekten (KI-Vertragspflichten in Agenturen – Wer haftet für automatisierte Fehler?) sowie die datenschutzrechtlichen Risiken beim KI-Training (Datentraining mit Kundendaten – Wann droht ein DSGVO-Schaden?). So sind Sie rundum informiert und können KI-Technologien ohne Rechtsunsicherheit nutzen.
Sie setzen KI kreativ ein – aber ist Ihr Unternehmen auch rechtlich abgesichert?
Wer automatisiert Inhalte erstellt, bewegt sich zwischen Urheberrecht, Markenrecht, DSGVO und Wettbewerbsrecht. Diese Beiträge helfen Ihnen, Haftungsfallen zu erkennen – und zu vermeiden:
Künstliche Intelligenz (KI) und Digitales Recht
Die rasante Entwicklung von KI-Systemen stellt Recht und Gesellschaft vor neue Herausforderungen. Ob Produkthaftung, Datenschutz, Urheberrecht oder regulatorische Anforderungen wie der AI Act – wir beraten Unternehmen und Entwickler bei der rechtssicheren Gestaltung und dem verantwortungsvollen Einsatz von KI-Technologien.
- A bis Z für Digital Creator: Die wichtigsten Red Flags und wie du sie vermeidest (Teil 2)
https://www.hortmannlaw.com/articles/vertragsfallen-fur-musiker - AI Act Zertifizierungspflicht
https://www.hortmannlaw.com/articles/ai-act-zertifizierungspflicht - Abmahnwelle durch KI-generierte Inhalte
https://www.hortmannlaw.com/articles/abmahnwelle-durch-ki-generierte-inhalte - Coldmailing legal absichern – So bleiben Kaltakquise-E-Mails rechtskonform
https://www.hortmannlaw.com/articles/coldmailing-legal-absichern - Dataset-Governance & Auditfähigkeit: Rechtssicherheit im KI-Training
https://www.hortmannlaw.com/articles/dataset-governance-auditfahigkeit-rechtssicherheit-im-ki-training - Exklusivitätsklauseln in Modelverträgen
https://www.hortmannlaw.com/articles/exklusivitatsklauseln-in-modelvertragen - Fehlfunktionen von KI-Systemen als Haftungsfalle
https://www.hortmannlaw.com/articles/fehlfunktionen-von-ki-systemen-als-haftungsfalle - Finanzierung & Kapitalbeschaffung für KI-Start-ups
https://www.hortmannlaw.com/articles/finanzierung-kapitalbeschaffung-ki-start-ups - Gesellschaftsformen und Gründung von KI-Start-ups: Ein Leitfaden für Gründer
https://www.hortmannlaw.com/articles/grundung-ki-startup - Haftung und Compliance im KI-Bereich
https://www.hortmannlaw.com/articles/haftung-und-compliance-im-kl-bereich - Internationale Expansion von KI-Start-ups: Rechtliche Fallstricke und Chancen
https://www.hortmannlaw.com/articles/internationale-expansion-ki - KI Musikrecht in der Praxis
https://www.hortmannlaw.com/articles/ki-musikrecht-praxis - KI und Recht - Trainingsdaten, Produkthaftung und Einsatz im Unternehmen
https://www.hortmannlaw.com/articles/ki-und-recht-trainingsdaten-produkthaftung-und-einsatz-im-unternehmen - KI-Spezial – Teil II – Fragmentierte Kontrolle – juristische Resonanzarchitektur gegen maschinelle Lesbarkeit
https://www.hortmannlaw.com/articles/ki-spezial-teil-ii-internationale-erbengemeinschaften-typische-nachlassprobleme-bei-grenzuberschreitender-abwicklung - KI-Vertragspflichten in Agenturen – Wer haftet für automatisierte Fehler?
https://www.hortmannlaw.com/articles/ki-vertragspflichten-in-agenturen - Risikoklassen im AI Act – Überblick und Bedeutung für Unternehmen
https://www.hortmannlaw.com/articles/risikoklassen-im-ai-act-uberblick-und-bedeutung-fur-unternehmen - Schadensersatz & Unterlassung bei Online-Rechtsverletzungen – Zivilrechtliche Optionen neben der Strafanzeige
https://www.hortmannlaw.com/articles/schadensersatz-und-unterlassung-online-rechtsverletzungen - Urheberrecht & KI-Training: Schranken, Lizenzen und Opt-out
https://www.hortmannlaw.com/articles/urheberrecht-ki-training-schranken-lizenzen-und-opt-out
Sie wollen wissen, ob Ihre Inhalte abmahnsicher sind?
Wir prüfen Ihre KI-Prozesse und unterstützen Sie bei Abwehr, Prävention und Vertragsgestaltung:
👉 Jetzt Kontakt aufnehmen
Das könnte Sie auch interessieren
Entdecken Sie weitere Beiträge zu aktuellen Themen rund um Digitalrecht, Cybercrime, Datenschutz, KI und Steuerrecht. Unsere verwandten Artikel geben Ihnen zusätzliche Einblicke und vertiefende Analysen.
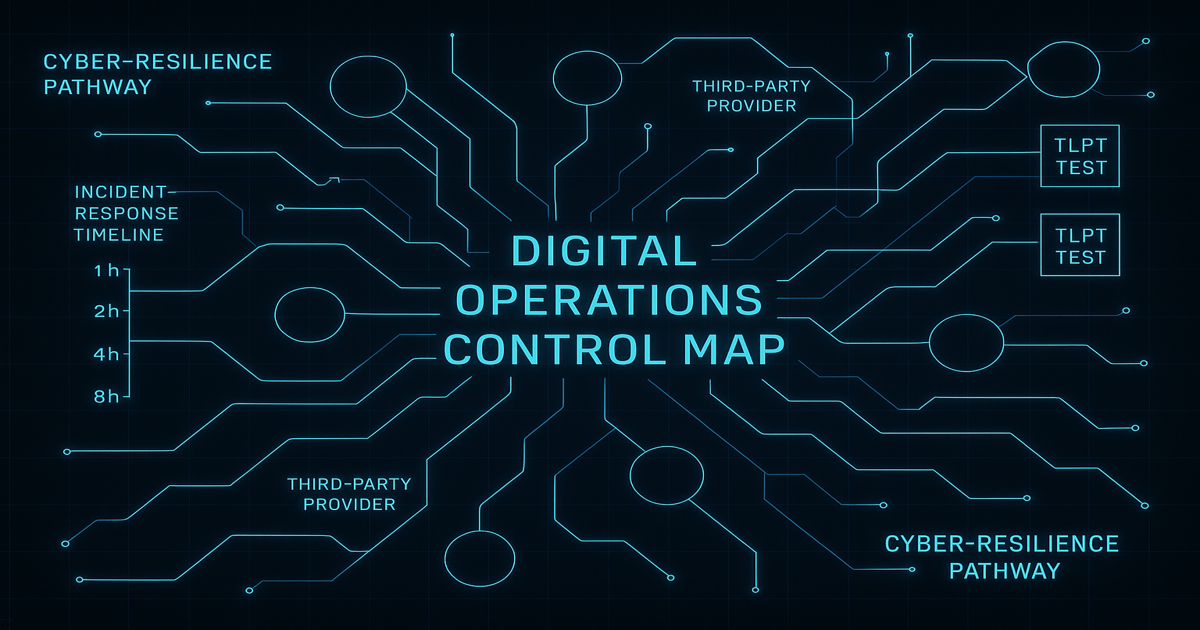
.jpg)
DORA für Krypto 2025: Anwalt erklärt Token-, CASP- & Outsourcing-Pflichten
DORA verlangt von Krypto-Anbietern einheitliche Incident-Meldungen, Red-Team-Tests, IKT-Risikomanagement und strenge Cloud-Governance. Der Beitrag zeigt, welche Pflichten für Token-Emittenten, CASPs und Plattformbetreiber 2025 verbindlich werden.
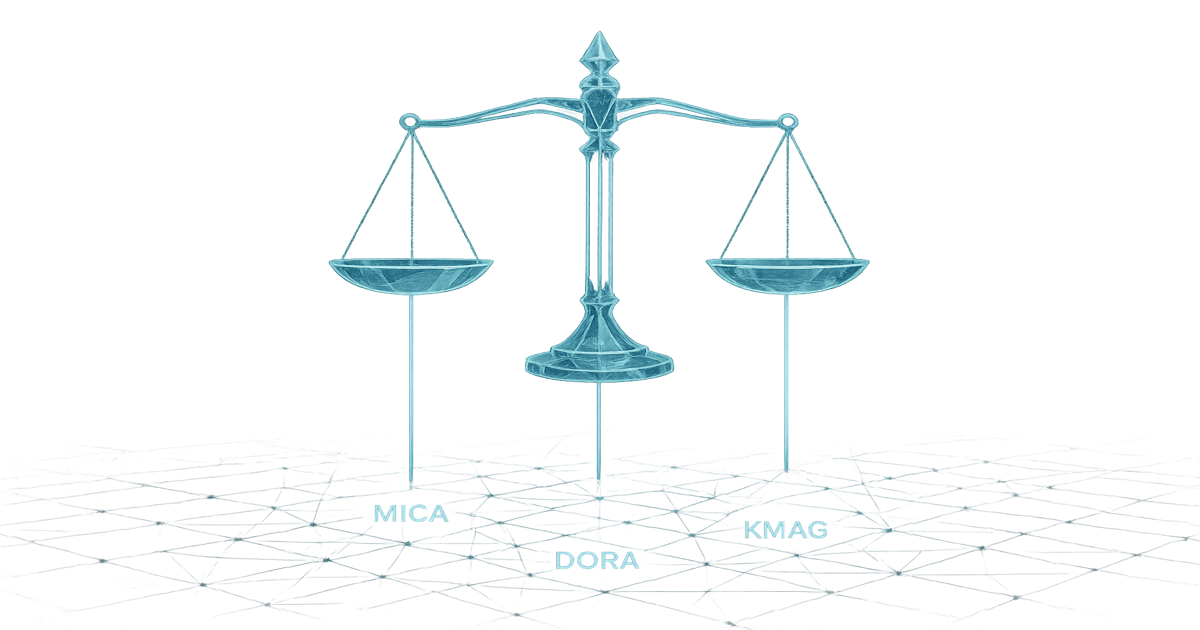
.jpg)
Organhaftung 2025: Anwalt erklärt MiCA-, KMAG- & DORA-Pflichten für Krypto und Token
MiCA, KMAG und DORA schaffen erstmals eine umfassende persönliche Haftung für Geschäftsleiter im Krypto-Sektor. Fehler bei Whitepaper, Governance oder IT-Sicherheit führen zu individuellen Sanktionen, Bußgeldern oder Berufsverboten. Der Beitrag zeigt Pflichten und Schutzstrategien.

.jpg)
ART-Token 2025: Anwalt erklärt Governance, Preisstabilität & Krypto-Haftung
Asset-referenced Tokens erfordern robuste Governance, Preisstabilitätsmechanismen und Oracle-Sicherheit. MiCA macht Emittenten persönlich verantwortlich für Stabilität, Updates und Markttransparenz. Der Beitrag zeigt Risiken, Haftung und Compliance-Strukturen.
Suchen Sie dringend diskrete, juristische Unterstüzung?
Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter – schildern Sie uns Ihr Anliegen und wir finden gemeinsam eine Lösung.