Urheberrecht & KI-Training: Schranken, Lizenzen und Opt-out
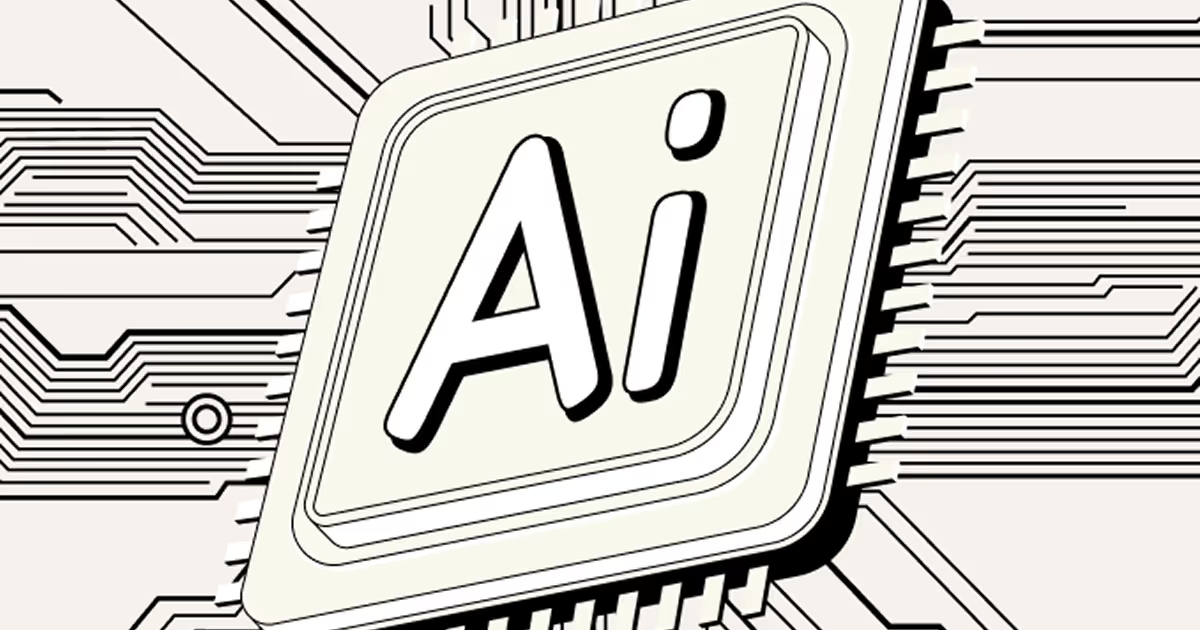

Juristische Expertise
- Cybercrime & Krypto-Betrug
- AI & Zukunftsrecht
- Steuerrecht & Steuerstrafrecht
- Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht & Zivilrecht
- Datenschutz & Digitalrecht
Urheberrecht & KI-Training: Schranken, Lizenzen und Opt-out
Einleitung: Warum Urheberrecht das Nadelöhr im KI-Training ist
Künstliche Intelligenz lebt von Inhalten – Texte, Bilder, Musik, Videos oder Code. Genau diese Inhalte sind aber in aller Regel urheberrechtlich oder leistungsschutzrechtlich geschützt. Unternehmen, die KI-Systeme trainieren, bewegen sich daher in einem sensiblen Bereich: Was rechtlich erlaubt ist, regeln die Schrankenbestimmungen für Text- und Data-Mining (TDM). Wo die Schranken nicht greifen, braucht es Lizenzen – oder man riskiert Unterlassungsklagen, Schadensersatzforderungen und Reputationsverluste.
Dieser Aufsatz zeigt, wie Unternehmen rechtssicher zwischen Schranke und Lizenzpflicht unterscheiden, welche Rolle Creative-Commons-Inhalte, AGB und ToS, Datenbankrechte und das Presse-Leistungsschutzrecht spielen und wie sich eine Compliance-taugliche Lizenzpraxis im Unternehmen etablieren lässt.
Überblick: Urheberrechtliche Leitplanken für KI-Training
- TDM-Schranken (§ 44b UrhG für kommerzielle Nutzung, § 60d UrhG für wissenschaftliche Forschung) definieren den Rahmen.
- Opt-out-Möglichkeiten der Rechteinhaber müssen technisch respektiert werden.
- Creative Commons & Open Content sind keine „freien Daten“ – Lizenzbedingungen sind einzuhalten.
- AGB & ToS von Plattformen können zusätzliche vertragliche Verbote enthalten, auch wenn das Urheberrecht eine Schranke vorsieht.
- Datenbanken & Presseverlegerrechte bilden zusätzliche Schutzschichten, die KI-Training lizenzpflichtig machen können.
- Vertragsgestaltung mit Datenlieferanten oder Partnern ist entscheidend, um Rechteketten abzusichern.
1. Die TDM-Schranken im Detail
1.1 § 44b UrhG – kommerzielles Text- und Data-Mining
§ 44b UrhG erlaubt es, rechtmäßig zugängliche Werke zu vervielfältigen, wenn dies ausschließlich dem Text- und Data-Mining dient.
Kernpunkte:
- Die Vorschrift gilt auch für Unternehmen, die Modelle zu kommerziellen Zwecken trainieren.
- „Rechtmäßig zugänglich“ bedeutet: nur Inhalte, die ohne Rechtsbruch abrufbar sind (keine Leaks, keine Umgehung von Paywalls oder DRM).
- Vorübergehende und dauerhafte Kopien sind zulässig, soweit sie für das Mining erforderlich sind.
Damit ist § 44b UrhG die wichtigste Rechtsgrundlage für kommerzielle Trainingspipelines, wenn keine individuelle Lizenz eingeholt werden soll.
1.2 § 60d UrhG – wissenschaftliches Data-Mining
Für die nicht-kommerzielle Forschung gibt es mit § 60d UrhG eine noch weitergehende Schranke:
- Adressaten: Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Bibliotheken.
- Besonderheit: Rechteinhaber können hier kein Opt-out erklären.
- Praxis: Ein Forschungsinstitut darf also große Text- oder Bildbestände crawlen und analysieren, auch wenn Rechteinhaber das nicht wünschen.
Grenze: Sobald die Ergebnisse für kommerzielle Zwecke verwendet werden, verlässt man § 60d und fällt zurück auf § 44b oder Lizenzpflicht.
1.3 Opt-out nach § 44b Abs. 3 UrhG
Das zentrale Gegengewicht zur Schranke ist das Opt-out-Recht: Rechteinhaber dürfen TDM untersagen.
- Form: Opt-out muss „in geeigneter Weise“ erklärt werden, typischerweise durch maschinenlesbare Formate (robots.txt, Meta-Tags, HTTP-Header).
- Pflicht: Crawler und Pipelines müssen solche Signale erkennen und respektieren.
- Beweislast: Unternehmen sollten dokumentieren, dass Opt-outs technisch verarbeitet und Quellen ausgeschlossen wurden.
Anti-Pattern: Viele Firmen betrachten robots.txt nur als „Empfehlung“. Im TDM-Recht ist sie eine rechtswirksame Schranke.
1.4 Grenzen der Schranke
Auch wenn § 44b großzügig klingt, gibt es enge Grenzen:
- Drei-Stufen-Test: Schranken dürfen die normale Werknutzung nicht beeinträchtigen oder die berechtigten Interessen der Rechteinhaber unzumutbar verletzen. Massives Crawling von Presseportalen könnte hier problematisch werden.
- Gezielte Kuratierung: Wer nicht nur massenhaft Daten verarbeitet, sondern gezielt bestimmte Werke auswählt (z. B. Bilder eines Künstlers), überschreitet die Schranke → Lizenzpflicht.
- Output-Nutzung: TDM erlaubt die Analyse, nicht die Wiedergabe. Gibt ein Modell längere Originalpassagen wieder, liegt ein Urheberrechtsverstoß vor.
1.5 Praktische Folgen für Unternehmen
- § 44b UrhG ist die rechtliche Basis für automatisiertes Crawling – aber nur, wenn Opt-outs eingehalten werden.
- Forschung kann sich auf § 60d stützen – kommerzielle Akteure nicht.
- Unternehmen müssen ihre Pipelines technisch so gestalten, dass sie Schranken- und Opt-out-Regeln respektieren.
- In Zweifelsfällen (gezielte Datensätze, Outputs mit hoher Werknähe) ist eine Lizenzierung Pflicht.
2. Creative Commons & Open Content: Chancen und Risiken für KI-Training
2.1 Warum Open Content attraktiv ist
Viele Entwickler und Unternehmen greifen auf Creative-Commons-Inhalte (CC) oder andere Open-Content-Quellen zurück. Grund: Diese Inhalte sind leicht verfügbar und scheinbar „frei“. Doch „frei“ bedeutet nicht „rechtsfrei“. Jede CC-Lizenz bringt Verpflichtungen mit sich – und wer diese im KI-Kontext nicht erfüllt, riskiert Lizenzverstöße.
2.2 Die wichtigsten CC-Lizenztypen im Überblick
- CC BY (Namensnennung erforderlich):
Nutzung erlaubt, auch kommerziell, aber der Urheber muss genannt werden.
→ Problem im KI-Training: Wie dokumentiert man Namensnennung bei Milliarden Trainingssamples? Unternehmen müssen ein Attributionskonzept entwickeln (z. B. Quelllisten oder Metadatenarchiv). - CC BY-SA (Share-Alike):
Nutzung erlaubt, aber abgeleitete Werke müssen unter denselben Bedingungen veröffentlicht werden.
→ Risiko: Manche Juristen argumentieren, dass auch ein trainiertes Modell als abgeleitetes Werk gilt. Dann müsste das Modell oder seine Outputs unter CC-Bedingungen stehen. - CC BY-NC (Non-Commercial):
Nutzung nur für nicht-kommerzielle Zwecke erlaubt.
→ KI-Training in Start-ups oder Unternehmen fällt in der Regel nicht darunter. Kommerzielles Training wäre ein klarer Verstoß. - CC BY-ND (No Derivatives):
Bearbeitungen sind verboten.
→ Fraglich, ob KI-Training eine Bearbeitung darstellt – viele gehen davon aus. Vorsicht: hier droht ein Risiko. - CC0 (Public Domain):
Verzicht auf alle Rechte. Nutzung ist frei möglich.
→ Dennoch: Quellen sollten dokumentiert werden, um Transparenz und Auditierbarkeit zu sichern.
2.3 Open-Source-Code im KI-Training
Auch Software-Code kann unter Open-Source-Lizenzen stehen, die KI-Training beeinflussen:
- MIT, Apache-2.0: relativ liberal.
- GPL/AGPL: Copyleft-Klauseln können „Rückwirkungen“ erzeugen.
→ Beispiel: Wenn ein KI-Modell mit GPL-Code trainiert wird, könnte diskutiert werden, ob auch das Modell unter GPL gestellt werden muss.
Praxisregel:
- Open-Source-Code nur trainieren, wenn Lizenzrisiken geklärt sind.
- Modell-Output sollte so gestaltet sein, dass kein urheberrechtlich geschützter Code reproduziert wird.
2.4 Risiken bei Open Content
- Lizenzbedingungen verletzen: Attribution vergessen, Share-Alike ignoriert, kommerzielle Nutzung bei NC-Inhalten → Lizenzbruch.
- Rechteketten unsicher: Manche Inhalte sind falsch als CC gekennzeichnet. Beispiel: Jemand lädt urheberrechtlich geschütztes Foto hoch und stellt es fälschlich unter CC.
- Verwechslungsgefahr: Plattformen wie Wikipedia oder Flickr mischen Inhalte mit unterschiedlichen Lizenzen – wer nicht prüft, riskiert Verstöße.
2.5 Empfehlungen für Unternehmen
- Lizenzmatrix führen: Für jeden genutzten CC-Datensatz Lizenztyp und Bedingungen dokumentieren.
- Attributionskonzept entwickeln: Namensnennung technisch und organisatorisch sicherstellen.
- Share-Alike prüfen: Vor Einsatz von BY-SA-Inhalten klären, ob sich die Pflicht auf das Modell erstrecken könnte.
- NC und ND meiden: Für kommerzielles Training ungeeignet.
- CC0 bevorzugen: Wo möglich, auf Public-Domain-Inhalte setzen – aber Dokumentation nicht vergessen.
3. AGB & ToS von Plattformen: Warum Verträge oft schärfer sind als Urheberrecht
3.1 Schranke vs. Vertrag: Wer gewinnt?
Das Urheberrecht erlaubt durch Schrankenregelungen wie § 44b UrhG unter bestimmten Bedingungen Text- und Data-Mining. Doch: Plattformen wie Social Media, Bilddatenbanken oder Newsportale können in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) oder Terms of Service (ToS) die Nutzung für KI-Training vertraglich untersagen.
→ Ergebnis: Auch wenn TDM urheberrechtlich erlaubt wäre, liegt bei Missachtung der AGB ein Vertragsbruch vor – mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen.
3.2 Typische Verbotsklauseln
Viele Plattformen haben in den letzten Jahren klare „No-AI“-Regeln aufgenommen, z. B.:
- „Kein Scraping“ von Inhalten, außer über offizielle APIs.
- „Keine Nutzung für KI-Training“ oder Machine Learning, wenn nicht ausdrücklich gestattet.
- „Nur persönliche Nutzung“, keine kommerzielle Weiterverwertung.
Beispiele aus der Praxis:
- Stockfoto-Plattformen untersagen oft die Verwendung ihrer Bilder für Trainingszwecke.
- Social-Media-Plattformen wie Twitter/X haben die API-Nutzung für KI-Projekte stark eingeschränkt.
- News-Verlage beginnen, explizit Verträge mit KI-Unternehmen auszuhandeln, statt Schranken gelten zu lassen.
3.3 Rechtsfolgen bei Missachtung
Ein Verstoß gegen die AGB hat andere Konsequenzen als ein Urheberrechtsverstoß:
- Unterlassung: Plattformen können sofortige Unterlassung verlangen.
- Schadensersatz: Vertragliche Ansprüche können teuer werden – auch ohne Nachweis eines klassischen Urheberrechtsverstoßes.
- Konto- oder Zugangsverlust: Accounts oder API-Schlüssel können gesperrt werden, was Projekte abrupt stoppen kann.
Wichtig: Vertragsverletzungen lassen sich nicht mit „aber das Urheberrecht erlaubt TDM“ rechtfertigen.
3.4 Praktische Handlungsempfehlungen
- ToS-Check etablieren: Vor Einbindung neuer Datenquellen müssen Juristen die AGB prüfen.
- Vertragsklauseln sichern: Wenn möglich, mit Plattformen oder Rechteinhabern explizite Vereinbarungen zur Nutzung für KI-Training schließen.
- Risikomanagement: Quellen mit restriktiven ToS klar kennzeichnen oder auf „Stop-Listen“ setzen.
- API vs. Scraping unterscheiden: Manche Plattformen erlauben KI-Nutzung über APIs, verbieten aber Crawling. Diese Differenz muss im Governance-Prozess dokumentiert werden.
4. Datenbank- und Presse-Leistungsschutzrechte: zusätzliche Hürden für KI-Training
4.1 Datenbankherstellerrecht (sui generis)
Neben dem klassischen Urheberrecht schützt die EU auch Investitionen in Datenbanken.
- Eine Datenbank ist nach § 87a UrhG geschützt, wenn eine wesentliche Investition in die Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung der Inhalte geflossen ist.
- Geschützt ist nicht der einzelne Datensatz, sondern die strukturierte Sammlung.
- Problem für KI-Training: Wer „wesentliche Teile“ einer geschützten Datenbank entnimmt oder wiederverwendet, verletzt dieses Recht.
Beispiele:
- Crawling großer Teile einer wissenschaftlichen Datenbank.
- Export einer Presse- oder Statistikdatenbank für Trainingszwecke.
→ Lösung: Entnahmen nur in nicht wesentlichem Umfang oder Lizenzvereinbarungen mit dem Datenbankbetreiber.
4.2 Presse-Leistungsschutzrecht
Seit 2019 gibt es in der EU das Leistungsschutzrecht für Presseverleger (§§ 87f ff. UrhG). Es schützt journalistische Pressepublikationen vor unlizenzierter Nutzung im Netz.
Kernpunkte:
- Schon kleine Auszüge (Snippets, Überschriften) können lizenziert werden müssen.
- Plattformen wie Google oder Facebook haben deshalb Verträge mit Verlagen geschlossen.
- Für KI-Training heißt das: Das massenhafte Crawlen von Nachrichtenportalen kann ohne Lizenz eine Verletzung darstellen, selbst wenn § 44b UrhG (TDM) formal greifen würde.
4.3 Zusammenspiel mit TDM-Schranken
- Grundsätzlich gilt: TDM-Schranken (§ 44b, § 60d UrhG) überlagern auch Datenbank- und Presse-Schutzrechte.
- Aber: Der Drei-Stufen-Test wirkt als Korrektiv. Wenn das Training die reguläre Verwertung von Presseinhalten oder Datenbanken unzumutbar beeinträchtigt, könnte eine Lizenzpflicht bestehen bleiben.
- Faktisch haben viele Verlage begonnen, Opt-outs zu erklären oder direkt Lizenzen mit KI-Unternehmenauszuhandeln.
4.4 Handlungsempfehlungen für Unternehmen
- Datenbankprüfung: Vor Nutzung klären, ob die Quelle unter § 87a UrhG fällt. Wenn ja, „wesentliche Teile“ nur mit Lizenz verwenden.
- Presseinhalte vorsichtig nutzen: Nachrichtenportale sind hochsensibel. Besser Lizenz oder Kooperation als stilles Crawlen.
- Stop-Listen einrichten: Für Quellen mit bekannten Leistungsschutzansprüchen (z. B. große Verlagshäuser) eindeutige Ausschlussregeln in den Pipelines definieren.
- Monitoring etablieren: Verfolgen, ob Verlage Opt-outs erklären oder Lizenzmodelle veröffentlichen.
5. Vertragsgestaltung mit Datenlieferanten und Partnern: Rechteketten absichern
5.1 Warum Verträge so wichtig sind
Auch wenn TDM-Schranken oder Open-Content-Lizenzen manches erlauben: Die größte Rechtssicherheit entsteht durch klare Verträge. Denn nur so können Unternehmen die gesamte Rechtekette nachvollziehen – vom ursprünglichen Urheber über Datenbroker bis zum eigenen Trainingsteam. Fehlt diese Absicherung, drohen Unterlassungsklagen, Abmahnungen oder sogar Rückabwicklungen ganzer Projekte.
5.2 Zentrale Vertragsklauseln
1. Nutzungszweck klar regeln
- Steht im Vertrag ausdrücklich, dass die Daten für „KI-Training und Machine Learning“ verwendet werden dürfen?
- Oder ist nur die interne Nutzung erlaubt?
2. Rechtekette absichern
- Lieferanten sollten garantieren, dass sie die nötigen Rechte selbst besitzen oder eingeholt haben.
- Typische Klausel: „Der Lieferant sichert zu, dass die gelieferten Daten frei von Rechten Dritter sind und für KI-Training genutzt werden dürfen.“
3. Freistellungsklauseln
- Falls doch Ansprüche Dritter geltend gemacht werden, verpflichtet sich der Lieferant, das KI-Unternehmen von allen Kosten freizustellen.
- Ohne solche Klauseln tragen Unternehmen das volle Risiko selbst.
4. Geheimhaltung und Vertraulichkeit
- Oft enthalten Datensätze sensible Informationen.
- NDAs (Non-Disclosure Agreements) sollten die Vertraulichkeit absichern – auch über die Trainingsphase hinaus.
5. Haftungsregelungen
- Klare Vereinbarungen, wer im Streitfall zahlt, schaffen Planungssicherheit.
- Pauschale Haftungsbeschränkungen der Lieferanten („keine Haftung für Rechte Dritter“) sind kritisch und sollten nicht akzeptiert werden.
5.3 Typische Problemfälle
- „Stillschweigende Nutzung“: Daten werden geliefert, aber nicht ausdrücklich für KI-Training freigegeben. → hohes Risiko.
- „Exklusive vs. nicht-exklusive Rechte“: Ohne klare Vereinbarung können Daten parallel an Wettbewerber verkauft werden.
- „Unklare Lizenzbedingungen bei Resellern“: Manche Datenbroker geben Rechte weiter, ohne die Originalrechte zu prüfen.
5.4 Handlungsempfehlungen
- Vor Nutzung externer Daten immer schriftliche Vereinbarungen einholen.
- Verträge von juristischen Experten prüfen lassen, insbesondere Lizenzklauseln und Freistellung.
- Rechtekette dokumentieren: Vom Urheber bis zum Training, damit im Auditfall ein sauberer Nachweis existiert.
- Nur mit Lieferanten arbeiten, die transparente Policies für KI-Training anbieten.
Fazit: Ohne Lizenzen kein sicheres KI-Training
Das Urheberrecht ist für KI-Training kein Nebenschauplatz, sondern das eigentliche Nadelöhr. Zwar erlauben die TDM-Schranken (§ 44b, § 60d UrhG) unter bestimmten Bedingungen automatisierte Analysen. Doch sobald Rechteinhaber Opt-outs erklären, Inhalte gezielt kurativer genutzt werden oder zusätzliche Leistungsschutzrechte greifen, bleibt nur der Weg über Lizenzen und klare Verträge.
Unternehmen müssen daher zweigleisig fahren:
- Technische Compliance durch Respekt vor Opt-outs, Crawler-Regeln und dokumentierte Datenkataloge.
- Juristische Compliance durch Lizenzprüfungen, AGB-Checks und belastbare Verträge mit Datenlieferanten.
Wer das umsetzt, kann KI-Modelle trainieren, ohne ständig die rote Karte von Rechteinhabern oder Gerichten zu riskieren – und gewinnt zusätzlich Vertrauen am Markt.
30/90/180-Tage-Plan für urheberrechtskonformes KI-Training
Innerhalb von 30 Tagen – Grundlagen schaffen
- Quelleninventur: Alle genutzten Websites, Datenbanken und Inhalte erfassen.
- Opt-out-Check: Crawler so konfigurieren, dass robots.txt, Meta-Tags und „No AI“-Hinweise technisch respektiert werden.
- Stop-Listen anlegen: Plattformen mit bekannten „No-AI“- oder restriktiven AGB identifizieren und ausschließen.
Innerhalb von 90 Tagen – Prozesse etablieren
- Lizenzmatrix aufbauen: Für jede Datenquelle Lizenztyp, CC-Bedingungen oder Vertragsstatus dokumentieren.
- Verträge prüfen: Lieferantenvereinbarungen auf KI-Nutzung, Freistellung und Rechtekette kontrollieren.
- Rechtsberatung einholen: Besonders bei Share-Alike (CC BY-SA) oder GPL/AGPL-Code Risiken bewerten lassen.
- Presse- und Datenbankquellen absichern: Klären, ob Leistungsschutzrechte greifen, ggf. Lizenz abschließen.
Innerhalb von 180 Tagen – Governance und Assurance
- Auditierbare Datenregister: Nachweis, woher Daten stammen und unter welchen Bedingungen sie genutzt werden.
- Output-Kontrollen: Similarity-Scanner und Leak-Guards, um Wiederholungen geschützter Werke zu verhindern.
- Lizenzprogramme: Kooperationen mit Verlagen, Bilddatenbanken oder Datenbrokern einrichten.
- Externes Audit oder Zertifizierung: Rechtssichere Nutzung durch unabhängige Prüfung dokumentieren.
Quintessenz
Urheberrechtliches KI-Training funktioniert nicht mit „Augen zu und durch“. Es braucht klare Strukturen, saubere Rechteketten und technisch-juristische Doppelabsicherung. Wer das beherzigt, spart nicht nur Rechtskosten, sondern legt den Grundstein für skalierbare, vertrauenswürdige KI-Systeme.
Künstliche Intelligenz (KI) und Digitales Recht
Die rasante Entwicklung von KI-Systemen stellt Recht und Gesellschaft vor neue Herausforderungen. Ob Produkthaftung, Datenschutz, Urheberrecht oder regulatorische Anforderungen wie der AI Act – wir beraten Unternehmen und Entwickler bei der rechtssicheren Gestaltung und dem verantwortungsvollen Einsatz von KI-Technologien.
- A bis Z für Digital Creator: Die wichtigsten Red Flags und wie du sie vermeidest (Teil 2)
https://www.hortmannlaw.com/articles/vertragsfallen-fur-musiker - AI Act Zertifizierungspflicht
https://www.hortmannlaw.com/articles/ai-act-zertifizierungspflicht - Abmahnwelle durch KI-generierte Inhalte
https://www.hortmannlaw.com/articles/abmahnwelle-durch-ki-generierte-inhalte - Coldmailing legal absichern – So bleiben Kaltakquise-E-Mails rechtskonform
https://www.hortmannlaw.com/articles/coldmailing-legal-absichern - Dataset-Governance & Auditfähigkeit: Rechtssicherheit im KI-Training
https://www.hortmannlaw.com/articles/dataset-governance-auditfahigkeit-rechtssicherheit-im-ki-training - Exklusivitätsklauseln in Modelverträgen
https://www.hortmannlaw.com/articles/exklusivitatsklauseln-in-modelvertragen - Fehlfunktionen von KI-Systemen als Haftungsfalle
https://www.hortmannlaw.com/articles/fehlfunktionen-von-ki-systemen-als-haftungsfalle - Finanzierung & Kapitalbeschaffung für KI-Start-ups
https://www.hortmannlaw.com/articles/finanzierung-kapitalbeschaffung-ki-start-ups - Gesellschaftsformen und Gründung von KI-Start-ups: Ein Leitfaden für Gründer
https://www.hortmannlaw.com/articles/grundung-ki-startup - Haftung und Compliance im KI-Bereich
https://www.hortmannlaw.com/articles/haftung-und-compliance-im-kl-bereich - Internationale Expansion von KI-Start-ups: Rechtliche Fallstricke und Chancen
https://www.hortmannlaw.com/articles/internationale-expansion-ki - KI Musikrecht in der Praxis
https://www.hortmannlaw.com/articles/ki-musikrecht-praxis - KI und Recht - Trainingsdaten, Produkthaftung und Einsatz im Unternehmen
https://www.hortmannlaw.com/articles/ki-und-recht-trainingsdaten-produkthaftung-und-einsatz-im-unternehmen - KI-Spezial – Teil II – Fragmentierte Kontrolle – juristische Resonanzarchitektur gegen maschinelle Lesbarkeit
https://www.hortmannlaw.com/articles/ki-spezial-teil-ii-internationale-erbengemeinschaften-typische-nachlassprobleme-bei-grenzuberschreitender-abwicklung - KI-Vertragspflichten in Agenturen – Wer haftet für automatisierte Fehler?
https://www.hortmannlaw.com/articles/ki-vertragspflichten-in-agenturen - Risikoklassen im AI Act – Überblick und Bedeutung für Unternehmen
https://www.hortmannlaw.com/articles/risikoklassen-im-ai-act-uberblick-und-bedeutung-fur-unternehmen - Schadensersatz & Unterlassung bei Online-Rechtsverletzungen – Zivilrechtliche Optionen neben der Strafanzeige
https://www.hortmannlaw.com/articles/schadensersatz-und-unterlassung-online-rechtsverletzungen - Urheberrecht & KI-Training: Schranken, Lizenzen und Opt-out
https://www.hortmannlaw.com/articles/urheberrecht-ki-training-schranken-lizenzen-und-opt-out
Das könnte Sie auch interessieren
Entdecken Sie weitere Beiträge zu aktuellen Themen rund um Digitalrecht, Cybercrime, Datenschutz, KI und Steuerrecht. Unsere verwandten Artikel geben Ihnen zusätzliche Einblicke und vertiefende Analysen.
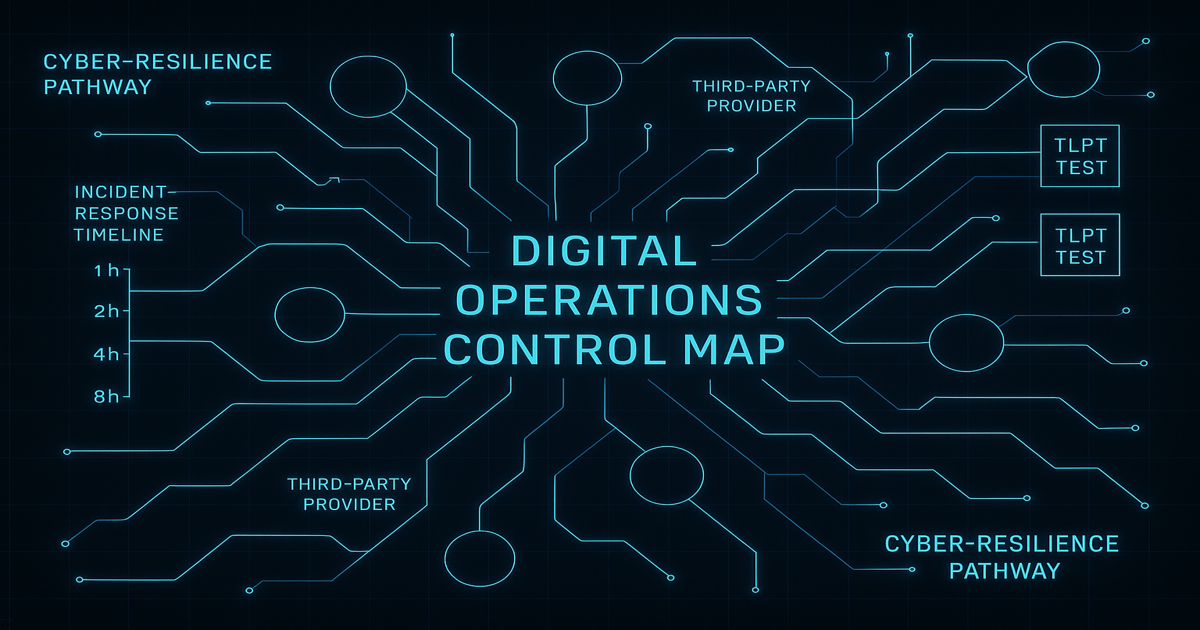
.jpg)
DORA für Krypto 2025: Anwalt erklärt Token-, CASP- & Outsourcing-Pflichten
DORA verlangt von Krypto-Anbietern einheitliche Incident-Meldungen, Red-Team-Tests, IKT-Risikomanagement und strenge Cloud-Governance. Der Beitrag zeigt, welche Pflichten für Token-Emittenten, CASPs und Plattformbetreiber 2025 verbindlich werden.
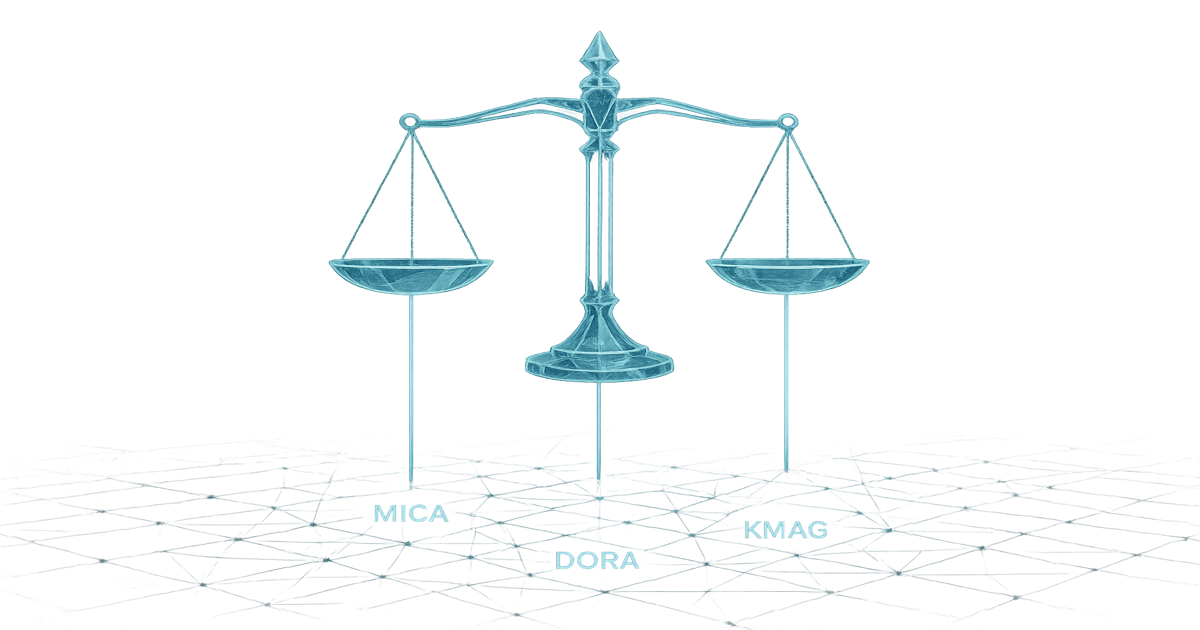
.jpg)
Organhaftung 2025: Anwalt erklärt MiCA-, KMAG- & DORA-Pflichten für Krypto und Token
MiCA, KMAG und DORA schaffen erstmals eine umfassende persönliche Haftung für Geschäftsleiter im Krypto-Sektor. Fehler bei Whitepaper, Governance oder IT-Sicherheit führen zu individuellen Sanktionen, Bußgeldern oder Berufsverboten. Der Beitrag zeigt Pflichten und Schutzstrategien.

.jpg)
ART-Token 2025: Anwalt erklärt Governance, Preisstabilität & Krypto-Haftung
Asset-referenced Tokens erfordern robuste Governance, Preisstabilitätsmechanismen und Oracle-Sicherheit. MiCA macht Emittenten persönlich verantwortlich für Stabilität, Updates und Markttransparenz. Der Beitrag zeigt Risiken, Haftung und Compliance-Strukturen.
Suchen Sie dringend diskrete, juristische Unterstüzung?
Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter – schildern Sie uns Ihr Anliegen und wir finden gemeinsam eine Lösung.