Fehlerhafte Direktvergabe – Wenn Eilentscheidungen zum Risiko werden


Juristische Expertise
- Cybercrime & Krypto-Betrug
- AI & Zukunftsrecht
- Steuerrecht & Steuerstrafrecht
- Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht & Zivilrecht
- Datenschutz & Digitalrecht
Fehlerhafte Direktvergabe – Wenn Eilentscheidungen zum Risiko werden
Einleitung
In Krisensituationen oder bei zeitkritischen Beschaffungen greifen öffentliche Auftraggeber häufig zu Direktvergaben – also Vergaben ohne formelles Wettbewerbsverfahren. Doch selbst unter Druck gilt das Vergaberecht uneingeschränkt: Eine unzulässige Direktvergabe kann gravierende rechtliche und finanzielle Folgen haben.
Von der Rückabwicklung des Vertrags bis zu Schadensersatzansprüchen, Disziplinarmaßnahmen und Fördermittelverlusten – die Risiken sind erheblich.
Dieser Beitrag erläutert, wann eine Direktvergabe zulässig ist, welche typischen Fehler auftreten und wie Auftraggeber ihre Verfahren rechtssicher gestalten können.
1. Rechtsgrundlage und Grundprinzip
Direktvergaben sind nur in engen Ausnahmefällen erlaubt.
Nach § 14 UVgO und § 14 VgV dürfen Aufträge ohne Wettbewerb vergeben werden, wenn:
- die Natur des Geschäfts (z. B. Geheimhaltung, Monopolstellung) dies erfordert,
- technische oder künstlerische Besonderheiten vorliegen,
- oder äußerste Dringlichkeit besteht, die keine Fristen für ein normales Verfahren zulässt.
Grundsatz:
Auch in Ausnahmesituationen muss die Vergabe transparent, dokumentiert und verhältnismäßig erfolgen. Jede Entscheidung muss nachträglich prüffähig sein.
2. Rechtswidrigkeit und Rückabwicklung (§ 135 GWB)
Ein Vertrag, der auf einer unzulässigen Direktvergabe beruht, ist nichtig (§ 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB).
Folgen:
- Der Vertrag gilt als von Anfang an unwirksam,
- bereits erbrachte Leistungen müssen rückabgewickelt werden,
- Zahlungen sind zurückzuerstatten,
- Auftraggeber dürfen die Leistung nicht weiter nutzen.
Die Rückabwicklung verursacht regelmäßig erhebliche finanzielle und organisatorische Schäden – insbesondere, wenn Bau- oder IT-Leistungen bereits umgesetzt wurden.
3. Schadensersatzansprüche von Wettbewerbern
Konkurrenten, die durch eine unzulässige Direktvergabe vom Wettbewerb ausgeschlossen wurden, können Schadensersatz verlangen (§ 181 GWB).
Mögliche Ansprüche:
- Entgangener Gewinn, wenn der Bieter bei ordnungsgemäßer Ausschreibung realistische Zuschlagschancen gehabt hätte,
- Kostenersatz für die Teilnahme an einem später aufgehobenen Verfahren oder die Rechtsverfolgung,
- Folgeschäden, z. B. Reputationsverluste oder vergebliche Investitionen.
Diese Ansprüche sind unabhängig vom Nachprüfungsverfahren und können auch zivilrechtlich geltend gemacht werden.

4. Disziplinar- und strafrechtliche Risiken
Fehlerhafte Direktvergaben können nicht nur verwaltungsrechtliche, sondern auch personelle Konsequenzen haben.
Disziplinarische Folgen:
- Dienstrechtliche Maßnahmen gegen Verantwortliche wegen Verstoßes gegen Haushaltsrecht (§ 7, § 55 BHO),
- Abmahnungen oder Rückstufungen bei wiederholten Vergabeverstößen.
Strafrechtliche Risiken:
- Subventionsbetrug (§ 264 StGB), wenn Fördermittel zweckwidrig verwendet wurden,
- Untreue (§ 266 StGB) bei grob fahrlässigem oder vorsätzlichem Haushaltsverstoß.
Die strafrechtliche Verantwortung trifft häufig auch Amtsleiter und Projektverantwortliche, die den Vergabeprozess nicht ausreichend überwachen.
5. Verlust von Fördermitteln
Bei EU- oder bundesgeförderten Projekten ist die korrekte Anwendung des Vergaberechts zwingende Fördervoraussetzung.
Konsequenzen bei Verstößen:
- Rückforderung der gesamten Förderung,
- Zinszahlungen auf zurückgeforderte Mittel,
- Ausschluss von zukünftigen Förderprogrammen.
Die Praxis zeigt: Schon formale Fehler in der Dokumentation oder Begründung der Direktvergabe führen zur Rückforderung ganzer Fördersummen – oft im sechsstelligen Bereich.
6. Einschränkungen im Nachprüfungsverfahren
Ein Nachprüfungsverfahren kann die Unwirksamkeit des Vertrags feststellen, wenn:
- der Auftraggeber keine Vorabinformation (§ 135 Abs. 2 GWB) veröffentlicht hat,
- der Auftragnehmer innerhalb von 30 Tagen nach Veröffentlichung der Bekanntmachung den Antrag stellt.
In der Praxis bedeutet dies: Auch abgeschlossene Verträge sind angreifbar, wenn sie rechtswidrig vergeben wurden.
Die Vergabekammer kann den Vertrag für unwirksam erklären, selbst wenn die Leistung schon erbracht wurde.
7. Transparenzpflicht und Bekanntmachung
Selbst bei rechtmäßigen Direktvergaben besteht eine Transparenzpflicht.
Nach § 135 Abs. 3 GWB müssen Auftraggeber die geplante Direktvergabe vorab im Amtsblatt der EU veröffentlichen.
Diese Bekanntmachung („Transparenzbekanntmachung“) dient dem Rechtsschutz potenzieller Bieter.
Wird sie unterlassen, gilt der Vertrag als nichtig – unabhängig davon, ob die Voraussetzungen einer Direktvergabe erfüllt waren.
8. Eilbedürftigkeit – kein Freifahrtschein
Oft wird Dringlichkeit als Rechtfertigung für eine Direktvergabe angeführt.
Doch auch in Notlagen gilt:
- Dringlichkeit muss nachweisbar und unverschuldet sein,
- sie darf nicht auf planerisches Versäumnis oder verzögerte Vorbereitung zurückgehen,
- und die Maßnahme muss verhältnismäßig sein.
Beispiel:
Ein öffentlicher Auftraggeber kann sich nicht auf Dringlichkeit berufen, wenn er seit Monaten von einer Frist wusste, aber zu spät mit der Ausschreibung begonnen hat.
9. Prävention und rechtssichere Gestaltung
Um Risiken zu vermeiden, sollten öffentliche Auftraggeber bei jeder Direktvergabe:
- Schriftliche Begründung der Ausnahme von der Ausschreibungspflicht dokumentieren,
- Transparenzbekanntmachung veröffentlichen,
- Vier-Augen-Prinzip anwenden (juristische und haushaltsrechtliche Prüfung),
- Lebenszykluskosten und Alternativangebote prüfen,
- Ex-post-Kontrolle durch interne Revisionsstellen oder Vergabebeauftragte veranlassen.
Ein systematisches Compliance-Management senkt nicht nur rechtliche Risiken, sondern auch den Druck in Prüfungsverfahren durch Rechnungshöfe und Fördermittelgeber.
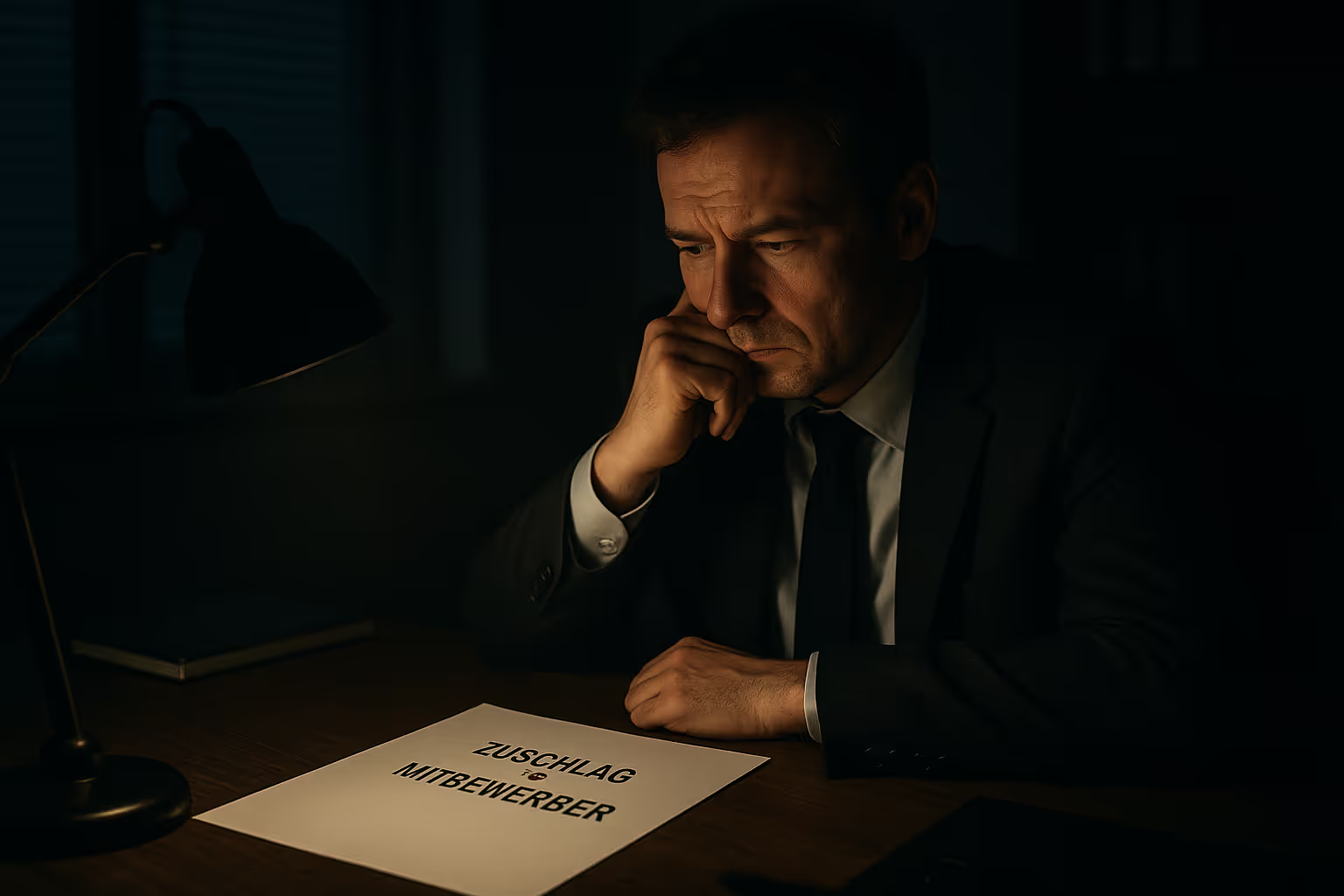
10. Fazit & Call-to-Action
Auch unter Zeitdruck gilt das Vergaberecht.
Eine fehlerhafte Direktvergabe ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein massiver Verstoß gegen Haushalts- und Wettbewerbsrecht – mit Folgen von der Rückabwicklung bis zu Disziplinarverfahren.
Wer Eilentscheidungen treffen muss, sollte sich frühzeitig juristisch absichern, statt auf „schnelle Lösungen“ zu setzen.
Sorgfältige Dokumentation, transparente Kommunikation und fundierte Begründung sind die besten Schutzmechanismen gegen spätere Prüfungen.
Wenn Sie Direktvergaben planen oder prüfen lassen möchten, unterstützen wir Sie bei der rechtssicheren Begründung und Dokumentation – für Ihre interne und externe Prüfungsfestigkeit.
👉 www.hortmannlaw.com/contact
☎ 0160 9955 5525
Weiterführende Beiträge zum Vergaberecht und zur Haushaltskontrolle
- § 55 BHO – Vergabegrundsatz und Kontrolle der Mittelverwendung
- Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit in Vergabeverfahren – Haushaltsrechtliche Leitplanken
- Nachprüfungsverfahren im Vergaberecht – Rechte und Strategien der Bieter
- Direktvergabe und ihre Risiken – Zwischen Effizienz und Rechtsverstoß
- Rügepflicht im Vergabeverfahren – Fristen, Form und Folgen
- Zuwendungsrecht und Vergabe – Zweckbindung und Mittelkontrolle im Fokus
- Rechnungshofprüfung in der Vergabe – Vorbereitung auf die Kontrolle öffentlicher Mittel
- Nachhaltigkeit in der öffentlichen Beschaffung – Zwischen Pflicht und Praxis
- Zuschlagsverbot und Rechtsschutz – Wann der Zuschlag gestoppt werden kann
- EU-Richtlinien im Vergaberecht – Einheitliche Standards und Umsetzung in Deutschland
📞 Kontakt: www.hortmannlaw.com/contact
Das könnte Sie auch interessieren
Entdecken Sie weitere Beiträge zu aktuellen Themen rund um Digitalrecht, Cybercrime, Datenschutz, KI und Steuerrecht. Unsere verwandten Artikel geben Ihnen zusätzliche Einblicke und vertiefende Analysen.

.jpg)
Dating App gründen: Was rechtlich zu beachten ist – Haftung, Steuern & Struktur
Eine Dating-App ist keine „Social App“, sondern ein daten- und monetarisierungsgetriebenes Intermediärsystem. Wer Premium, Boosts und Coins anbietet, betreibt nicht nur Produktdesign, sondern schafft rechtlich relevante Leistungsversprechen, Risiken der Plattformverantwortung, bilanzielle Verpflichtungen und Governance‑Pflichten der Geschäftsleitung. Dieser Beitrag zeigt aus Herausgeber‑ und Entwicklerperspektive, wie man eine Dating‑Plattform in Deutschland/EU strukturiert, sodass Haftung, Regulierung und Steuerfolgen beherrschbar bleiben – nicht durch spätere AGB‑Kosmetik, sondern durch Architektur am Anfang.

.jpg)
Krypto-Betrug & Anlagebetrug, Lovescam, Geld zurück: Anwalt erklärt Maschen, Bankhaftung und rechtliche Schritte
Viele angebliche Krypto- oder Online-Investments sind kein Marktrisiko, sondern gezielter Betrug. Täter arbeiten mit professionellen Plattformen, scheinbaren Kontoständen und vorgetäuschten Auszahlungen. Betroffene verlieren oft hohe Summen – häufig unter Mitwirkung von Banken oder Zahlungsdienstleistern, die Warnsignale übersehen haben. Ein spezialisierter Anwalt prüft Strafanzeige, Beweise und mögliche Haftungsansprüche gegen Banken.

.jpg)
Umsatzsteuer & Token & Mica 2025: Anwalt erklärt Bitcoin-Befreiung, NFT-Steuer und digitale Risiken
Der Artikel zeigt, warum Bitcoin-Umtausch umsatzsteuerfrei bleibt, NFTs jedoch regelmäßig steuerpflichtige digitale Leistungen darstellen. Erläutert werden die neuen Risiken für Token-Modelle, Creator, Plattformen und digitale Dienstleistungen – und wie man Umsatzsteuerfallen, Prüfungen und Strafrisiken wirksam vermeidet.
Suchen Sie dringend diskrete, juristische Unterstüzung?
Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter – schildern Sie uns Ihr Anliegen und wir finden gemeinsam eine Lösung.