EU-Vergaberichtlinien in der Praxis – Wenn nationales Recht an Grenzen stößt
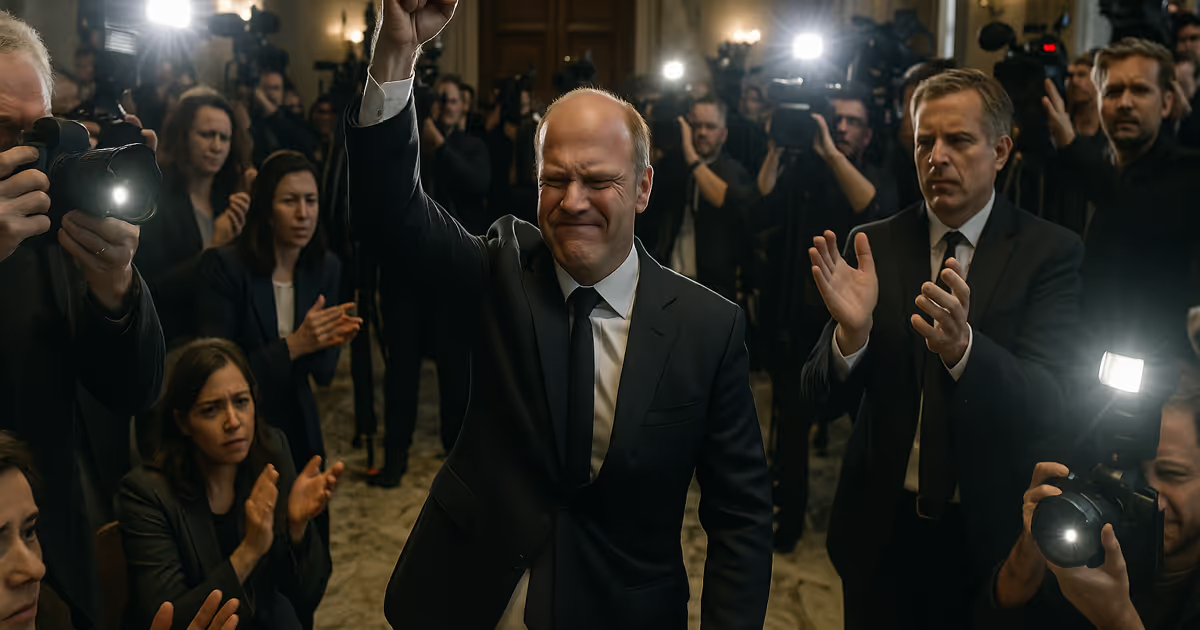

Juristische Expertise
- Cybercrime & Krypto-Betrug
- AI & Zukunftsrecht
- Steuerrecht & Steuerstrafrecht
- Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht & Zivilrecht
- Datenschutz & Digitalrecht
EU-Vergaberichtlinien in der Praxis – Wenn nationales Recht an Grenzen stößt
Einleitung
Das Vergaberecht ist längst keine rein nationale Materie mehr.
Seit der Umsetzung der EU-Vergaberichtlinien 2014/23/EU, 2014/24/EU und 2014/25/EU bilden europäische Vorgaben das Fundament für die Vergabe öffentlicher Aufträge in Deutschland.
Diese Richtlinien setzen einheitliche Mindeststandards für Transparenz, Gleichbehandlung und Wettbewerb – und haben Vorrang vor nationalen Regelungen, wenn diese im Widerspruch stehen.
Für öffentliche Auftraggeber bedeutet das: Wer europäische Vorgaben missachtet, riskiert nicht nur Nachprüfungsverfahren, sondern auch Vertragsnichtigkeit, Rückforderungen und Rechnungshof-Beanstandungen.
1. Anwendungsvorrang des EU-Rechts
a) Grundsatz des Anwendungsvorrangs
Nach Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG und der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) gilt:
Unionsrecht hat Vorrang vor nationalem Recht.
Das bedeutet:
- Nationale Vergabevorschriften, die EU-Vorgaben widersprechen, sind nicht anwendbar.
- Öffentliche Auftraggeber müssen EU-Recht direkt umsetzen, auch wenn nationale Gesetze oder Verwaltungspraxis etwas anderes vorsehen.
Beispiel aus der Praxis:
Das Verwaltungsgericht Augsburg stoppte ein Grundstücksvergabeverfahren, weil das zugrunde liegende „Einheimischenmodell“ gegen die unionsrechtliche Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) verstieß.
(→ VG Augsburg, Gerichtsbescheid vom 07.10.2019, Au 7 K 18.327)
b) Folge: Unionsrechtswidrigkeit verdrängt nationales Recht
Wenn nationale Kriterien unionsrechtswidrig sind, müssen sie unangewendet bleiben.
Die Vergabestelle muss das Verfahren dann neu starten – mit EU-konformen Kriterien.
Bieter, die sich nicht erneut beteiligen, verlieren ihre Zuschlagschance.
2. Effektiver Rechtsschutz nach europäischem Standard
Die EU-Vergaberichtlinien verpflichten die Mitgliedstaaten, einen effektiven und zügigen Rechtsschutz für Bieter zu gewährleisten.
Dies betrifft insbesondere den Zugang zu Nachprüfungsverfahren und einstweiligem Rechtsschutz.
a) Anforderungen der EU-Richtlinien
Gemäß Art. 1 Abs. 1 und 3 der Rechtsmittelrichtlinie 89/665/EWG müssen Mitgliedstaaten sicherstellen, dass:
- Bieter unabhängigen Rechtsschutz gegen Vergabeverstöße haben,
- die Verfahren wirksam und beschleunigt durchgeführt werden,
- und die Rechtsschutzmechanismen nicht durch nationale Fristen oder Formalismen entwertet werden.
b) Nationale Umsetzung in Deutschland
Deutschland erfüllt diese Vorgabe durch:
- §§ 155 ff. GWB (Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer),
- § 173 GWB (einstweiliger Rechtsschutz),
- und das automatische Zuschlagsverbot (§ 169 GWB).
Damit stellt das GWB sicher, dass Bieter ihre Rechte vor Zuschlagserteilung effektiv sichern können – im Einklang mit EU-Recht.
3. Konsequenzen bei EU-rechtswidrigen Vergaben
a) Unwirksamkeit von Verträgen (§ 135 GWB)
Verstöße gegen EU-Vorgaben – etwa bei Informations- und Wartepflichten (§ 134 GWB) – können zur Unwirksamkeit eines Vertrags führen.
Dies gilt insbesondere, wenn:
- kein EU-weites Verfahren durchgeführt wurde, obwohl es erforderlich war,
- der Auftrag ohne Vorabinformation erteilt wurde,
- oder der Zuschlag während eines laufenden Nachprüfungsverfahrens erfolgte.
Rechtsfolge:
Der Vertrag ist nichtig, muss rückabgewickelt werden, und der Auftraggeber riskiert finanzielle und disziplinarische Konsequenzen.
b) Beanstandungen durch Rechnungshöfe und Fördermittelgeber
Fehlerhafte Vergaben führen häufig zu:
- Rückforderungen von EU- oder Bundesmitteln,
- Sperrung von Fördergeldern,
- oder Beanstandungen durch Rechnungshöfe wegen Verletzung der Haushaltsgrundsätze (§ 7, § 55 BHO).

4. Typische Konfliktfelder zwischen EU- und nationalem Recht
a) Haushaltsrecht vs. Wettbewerbsprinzip
Das deutsche Haushaltsrecht (BHO/LHO) verpflichtet zur Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit.
EU-Recht verlangt jedoch Transparenz und Wettbewerb – auch wenn dies kurzfristig teurer erscheint.
Ergebnis: Der Preis darf nicht allein entscheidend sein, wenn dadurch EU-Wettbewerbsgrundsätze verletzt werden.
b) Einheimischenmodelle und Regionalboni
Regionale Bevorzugungen, z. B. für ortsansässige Unternehmen oder Bürger („Einheimischenmodelle“), verstoßen gegen:
- die Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV),
- das Diskriminierungsverbot (Art. 18 AEUV).
Diese Modelle sind unionsrechtswidrig, auch wenn sie im nationalen Interesse liegen.
c) Direktvergaben und Dringlichkeitsausnahmen
EU-Recht akzeptiert Ausnahmen vom Vergabeverfahren nur bei nachweisbarer äußerster Dringlichkeit (Art. 32 Abs. 2 lit. c Richtlinie 2014/24/EU).
Nationale oder politische Begründungen („zeitlicher Druck“) reichen nicht aus.
5. Effekt des EU-Rechts auf nationale Nachprüfungsverfahren
a) Vorrang des EU-Primärrechts
Die Vergabekammern und Oberlandesgerichte sind verpflichtet, EU-rechtskonforme Auslegung sicherzustellen.
Ist dies nicht möglich, müssen sie nationales Recht unangewendet lassen.
b) Europarechtskonformer einstweiliger Rechtsschutz
Ein wirksamer Rechtsschutz muss auch vorläufige Maßnahmen ermöglichen, um zu verhindern, dass rechtswidrige Verträge vollzogen werden (EuGH, Rs. C-81/98 Alcatel).
Daher können Vergabekammern nach § 169 und § 173 GWB den Zuschlag aussetzen oder untersagen, bis über die Rechtmäßigkeit entschieden ist.
6. Praxisempfehlungen für Auftraggeber
- EU-Schwellenwerte prüfen:
Immer ermitteln, ob der geschätzte Auftragswert die EU-Grenzen überschreitet. - EU-weite Bekanntmachung:
Veröffentlichung in TED (Tenders Electronic Daily) bei EU-Verfahren. - Vergabeunterlagen prüfen:
Keine diskriminierenden oder regional beschränkten Kriterien aufnehmen. - Dokumentation:
Begründung von Ausnahmen (z. B. Dringlichkeit) immer schriftlich festhalten. - Rechtsentwicklung beobachten:
EU-Vorgaben ändern sich regelmäßig – laufende Schulungen und Updates sind essenziell.

7. Fazit & Call-to-Action
Die EU-Vergaberichtlinien sind nicht nur Rahmenvorgaben – sie sind bindendes Recht, das nationales Haushalts- und Vergaberecht überlagert.
Wer ihre Prinzipien ignoriert, riskiert Rechtswidrigkeit, Vertragsnichtigkeit und Rückforderungen.
Öffentliche Auftraggeber müssen ihre Verfahren europarechtskonform auslegen und dokumentieren – von der Bekanntmachung bis zur Zuschlagsentscheidung.
Bieter wiederum können sich direkt auf EU-Recht berufen, wenn nationale Vorschriften den effektiven Rechtsschutz behindern.
Wenn Sie prüfen möchten, ob Ihre Vergabeverfahren EU-konform sind oder welche Risiken drohen, beraten wir Sie fundiert und praxisnah – mit Fokus auf Rechtssicherheit, Transparenz und Effizienz.
👉 www.hortmannlaw.com/contact
☎ 0160 9955 5525
Weiterführende Beiträge zum Vergaberecht und zur Haushaltskontrolle
- § 55 BHO – Vergabegrundsatz und Kontrolle der Mittelverwendung
- Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit in Vergabeverfahren – Haushaltsrechtliche Leitplanken
- Nachprüfungsverfahren im Vergaberecht – Rechte und Strategien der Bieter
- Direktvergabe und ihre Risiken – Zwischen Effizienz und Rechtsverstoß
- Rügepflicht im Vergabeverfahren – Fristen, Form und Folgen
- Zuwendungsrecht und Vergabe – Zweckbindung und Mittelkontrolle im Fokus
- Rechnungshofprüfung in der Vergabe – Vorbereitung auf die Kontrolle öffentlicher Mittel
- Nachhaltigkeit in der öffentlichen Beschaffung – Zwischen Pflicht und Praxis
- Zuschlagsverbot und Rechtsschutz – Wann der Zuschlag gestoppt werden kann
- EU-Richtlinien im Vergaberecht – Einheitliche Standards und Umsetzung in Deutschland
📞 Kontakt: www.hortmannlaw.com/contact
Das könnte Sie auch interessieren
Entdecken Sie weitere Beiträge zu aktuellen Themen rund um Digitalrecht, Cybercrime, Datenschutz, KI und Steuerrecht. Unsere verwandten Artikel geben Ihnen zusätzliche Einblicke und vertiefende Analysen.

.jpg)
Dating App gründen: Was rechtlich zu beachten ist – Haftung, Steuern & Struktur
Eine Dating-App ist keine „Social App“, sondern ein daten- und monetarisierungsgetriebenes Intermediärsystem. Wer Premium, Boosts und Coins anbietet, betreibt nicht nur Produktdesign, sondern schafft rechtlich relevante Leistungsversprechen, Risiken der Plattformverantwortung, bilanzielle Verpflichtungen und Governance‑Pflichten der Geschäftsleitung. Dieser Beitrag zeigt aus Herausgeber‑ und Entwicklerperspektive, wie man eine Dating‑Plattform in Deutschland/EU strukturiert, sodass Haftung, Regulierung und Steuerfolgen beherrschbar bleiben – nicht durch spätere AGB‑Kosmetik, sondern durch Architektur am Anfang.

.jpg)
Krypto-Betrug & Anlagebetrug, Lovescam, Geld zurück: Anwalt erklärt Maschen, Bankhaftung und rechtliche Schritte
Viele angebliche Krypto- oder Online-Investments sind kein Marktrisiko, sondern gezielter Betrug. Täter arbeiten mit professionellen Plattformen, scheinbaren Kontoständen und vorgetäuschten Auszahlungen. Betroffene verlieren oft hohe Summen – häufig unter Mitwirkung von Banken oder Zahlungsdienstleistern, die Warnsignale übersehen haben. Ein spezialisierter Anwalt prüft Strafanzeige, Beweise und mögliche Haftungsansprüche gegen Banken.

.jpg)
Umsatzsteuer & Token & Mica 2025: Anwalt erklärt Bitcoin-Befreiung, NFT-Steuer und digitale Risiken
Der Artikel zeigt, warum Bitcoin-Umtausch umsatzsteuerfrei bleibt, NFTs jedoch regelmäßig steuerpflichtige digitale Leistungen darstellen. Erläutert werden die neuen Risiken für Token-Modelle, Creator, Plattformen und digitale Dienstleistungen – und wie man Umsatzsteuerfallen, Prüfungen und Strafrisiken wirksam vermeidet.
Suchen Sie dringend diskrete, juristische Unterstüzung?
Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter – schildern Sie uns Ihr Anliegen und wir finden gemeinsam eine Lösung.

