Klage gegen Crypto.com & Co: Wie Opfer von Krypto-Betrug, Bitcoin- und Love-Scam-Fällen vor Gericht Erfolg haben


Juristische Expertise
- Cybercrime & Krypto-Betrug
- AI & Zukunftsrecht
- Steuerrecht & Steuerstrafrecht
- Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht & Zivilrecht
- Datenschutz & Digitalrecht
Klage gegen Crypto.com & Co – Was passiert, wenn Sie eine Krypto-Plattform wirklich verklagen?
Wer Crypto.com, Binance oder eine andere Krypto-Plattform verklagt, tut etwas, das viele Mandanten anfangs für „unmöglich“ halten – und was sich in der Praxis immer wieder als wirksam erweist. Eine Klage zwingt Plattformen, erstmals intern zu prüfen, was passiert ist, welche Wallets betroffen waren und ob die eigene Haftung vermieden werden kann. Wo vorher auf E-Mails geschwiegen wurde, antwortet nun eine Rechtsabteilung. Das Verfahren bringt Daten ans Licht – und oft mehr Bewegung als alle Anzeigen davor.
Wie RA Max N. M. Hortmann in seinem Aufsatz „Plattformverantwortlichkeit und Datenzugang“ betont:
„Die Zunahme von Betrugsfällen über internationale Kryptoplattformen wie crypto.com oder Binance stellt die anwaltliche Praxis vor neue Herausforderungen. Geschädigte Anleger verlieren erhebliche Vermögenswerte, während die Täter im Regelfall anonym bleiben […]. Für die Durchsetzung von Ersatzansprüchen rücken damit die Plattformbetreiber selbst in den Fokus.“
AnwZert-ITR_19_2025
Genau darum geht es in diesem Beitrag: Wie Sie als geschädigte Partei nicht nur Ihre Geschichte aufbereiten – sondern auch gerichtsfest vortragen, Beweise sichern und die Plattform zu einer echten Reaktion zwingen.
Juristische Grundlage: Wann kann man eine Krypto-Plattform verklagen?
Der Betrug beginnt meist nicht bei der Plattform, sondern bei Dritten: Romance-Scammer, vermeintliche Broker, Social-Media-Fakes. Doch das Geld landet – direkt oder indirekt – auf Wallets, die bei Plattformen wie Crypto.com geführt werden. Dort setzt die zivilrechtliche Verantwortung an.
Die Anspruchsgrundlagen:
- § 826 BGB (sittenwidrige Schädigung)
- § 823 Abs. 2 BGB i. V. m. § 263 StGB (Betrug)
- §§ 812, 830 BGB (Bereicherung, Mittäter)
Ob die Plattform haftet, hängt davon ab, ob sie den Geldfluss ermöglicht, verschleiert oder nicht gestoppt hat, obwohl sie den Verdacht hätte erkennen können. Auch ohne eigenes Täuschen kann sie als faktische Verwalterin betrugsrelevanter Wallets haften – wenn technische oder organisatorische Mängel nachweisbar sind.
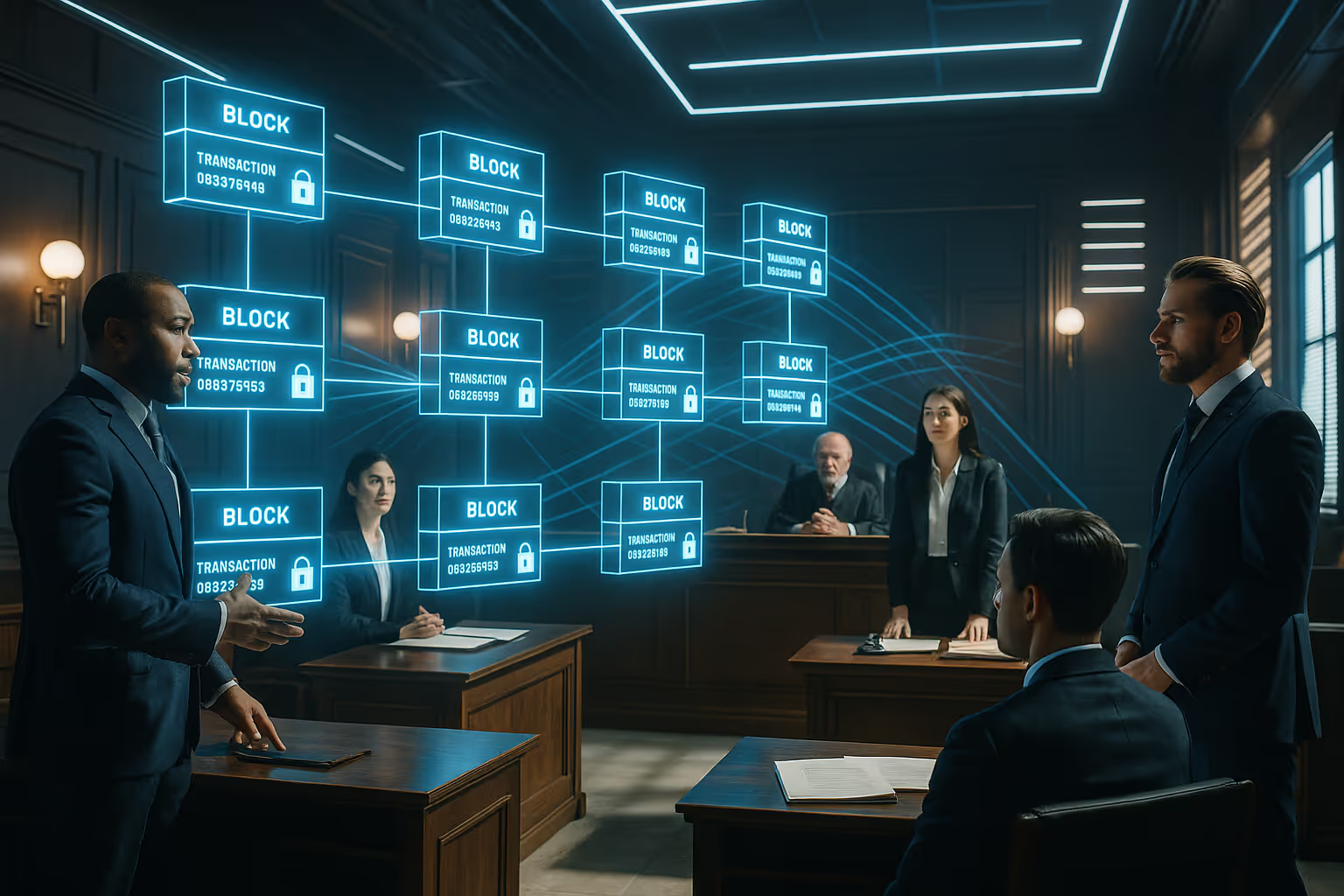
Zuständigkeit und internationale Klagehürden
Viele Plattformen sitzen im Ausland (Singapur, Malta, Irland), haben aber deutschsprachige Websites und richten sich aktiv an deutsche Nutzer. Das eröffnet regelmäßig Zuständigkeit deutscher Gerichte nach Art. 7 Nr. 2 Brüssel Ia-VO: Schadenseintritt in Deutschland = Gerichtsstand. Die Plattform wird dann per Auslandszustellung erreicht (Haager Zustellungsübereinkommen, EuZustVO). Bei Erfolg wird das Urteil EU-weit vollstreckbar – ein nicht zu unterschätzendes Druckmittel.
Wie Plattformen auf Klagen reagieren – aus Sicht der Praxis
Phase 1 – Abwarten: Nach Klagezustellung folgt fast immer ein Antrag auf Fristverlängerung. Plattformen möchten Zeit gewinnen, um die Lage intern zu bewerten.
Phase 2 – Substanzprüfung: Sie prüfen, ob Beweise tragfähig sind, ob KYC-Daten oder Logs den Fall gefährlich machen.
Phase 3 – Taktische Verteidigung: Falls Klage nicht solide geführt ist, wird sie angegriffen: auf Unzuständigkeit, Form, unzureichende Substantiierung.
Phase 4 – Vergleich oder Blockade: Bei guter Beweislage werden Vergleiche sondiert – oft still, oft spät.
Wichtig: Je besser Ihre anwaltlich koordinierte Forensik ist, desto eher reagiert die Plattform. Wer sauber vorträgt, setzt sich durch.
Forensische Vorbereitung: Was Sie vor Klageeinreichung brauchen
Die Beweislast liegt beim Kläger. Sie müssen zeigen, dass:
- Geld auf ein Wallet bei der Plattform geflossen ist.
- dies durch Täuschung veranlasst war.
- die Plattform organisatorisch hätte erkennen können/müssen, dass es sich um einen Betrug handelt.
Das bedeutet konkret:
- Screenshots und Export der Wallet-Transaktionen (Hash, Betrag, Zeitstempel)
- Chats, Mails, falsche „Broker“-Dokumente, Voice-Messages
- Blockchain-Analyse mit Zielwallet (Chainalysis, TRM Labs etc.)
- Auskunft aus Ermittlungsakten (nach Strafanzeige)
Außerdem müssen Sie mit Ihrem Anwalt klären:
- Wurden zuvor ähnliche Fälle auf der Plattform gemeldet?
- Wurde das Empfänger-Wallet mit KYC-Daten hinterlegt?
- Wurden interne Warnsysteme ignoriert?
Beweisanträge vor Gericht: Wie man Plattformen zur Herausgabe zwingt
Kern der Strategie: Plattformdaten sichern. Gerichte können auf Antrag die Herausgabe folgender Daten anordnen:
- KYC-Daten (Ident-Nachweise des Empfänger-Wallet-Inhabers)
- IP-Logs, Zugriffshistorien, Authentifizierungsprotokolle
- Transaktionsverläufe innerhalb der Plattform
- Sicherheitsvermerke (verdächtiges Verhalten, gemeldete Fälle)
Was Plattformen tun:
- Datenschutz einwenden
- Serverstandort vorschieben
- „Unkenntnis“ behaupten
Was Gerichte erwarten:
- technisch präzise Anträge (nicht: „alle Daten bitte“, sondern: „Herausgabe von KYC und IP-Logs für Wallet XYZ123, Zeitraum …“)
- darlegbare Erforderlichkeit für jeden einzelnen Beleg
Best Practice: Kombination aus Blockchain-Report, Chatbelegen und strukturiertem Zahlungsablauf. So lässt sich zeigen: „Ohne Plattformintervention war der Schaden nicht vermeidbar.“

Mündliche Verhandlung: Wo Technik auf Recht trifft
In der mündlichen Verhandlung wird das Verfahren greifbar. Technische Details werden reduziert auf Kausalfragen:
- Wusste die Plattform (durch Logs, frühere Meldungen, Auffälligkeiten), dass der Wallet-Nutzer betrügt?
- Hätte sie (nach KYC, Transaktionsmustern) handeln müssen?
- Hat sie es dennoch unterlassen?
Viele Richter:innen lassen Sachverständige erklären, wie Blockchain-Nachverfolgung funktioniert. Plattformanwälte weichen auf Standardantworten aus – es sei technisch unmöglich, Wallets intern zu prüfen. Faktisch ist das falsch. Ihre Forensik zeigt, wie es geht.
Oft folgt dann ein Beweisbeschluss – oder der Druck steigt, um Vergleich zu schließen. Plattformen scheuen öffentliche Urteile.
Bankpflichtverletzung mitdenken – und ggf. parallel klagen
Fast alle Betrugsopfer zahlen zuerst von ihrem Bankkonto – per SEPA, Kreditkarte oder Sofortüberweisung. Banken haben Warnpflichten (§ 675u BGB), wenn auffällige Zahlungen erfolgen (z. B. 50.000 € nach Malta mit Betreff „Bitcoin Investment“).
Wird ohne Rückfrage ausgeführt, liegt unter Umständen eine Organisationspflichtverletzung vor.
Parallelstrategie:
– Klage gegen Plattform: wegen Untätigkeit / KYC-Mängel
– Klage gegen Bank: wegen Sorgfaltspflichtverletzung
Zwei parallele Verfahren – jeweils mit eigenem Ziel.
Gerichte erkennen die Verbindung und berücksichtigen, ob beide Akteure den Schaden mitverursacht haben.
Wie lange dauert das – und wie realistisch ist ein Erfolg?
Erfahrungsgemäß:
- 3–6 Monate bis zur ersten Reaktion der Plattform
- 6–12 Monate bis zur Beweisaufnahme
- 12–18 Monate bis zum Urteil oder Vergleich
Was Banken oft machen:
– hart bleiben bis zur Beweisaufnahme
– dann still anbieten, einen Teil des Schadens zu übernehmen (z. B. 50–70 %)
– gleichzeitig verlangen, dass das Urteil nicht veröffentlicht wird
Was Plattformen oft machen:
– blockieren so lange wie möglich
– aber bei guter Beweislage (v. a. öffentlichem Interesse, strukturiertem Betrugsnetz) kommt Bewegung
– häufig werden Rückzahlungen angeboten „ohne Schuldanerkenntnis“, um das Verfahren zu beenden
.avif)
Fazit: Klage ist kein Symbolakt – sondern die einzige Sprache, die Plattformen verstehen
Wer Crypto.com, Binance oder ähnliche Plattformen zivilrechtlich angreift, braucht Geduld, Struktur und Strategie. Doch der Effekt ist real: Plattformen, die vorher nicht reagierten, öffnen interne Datensysteme, wenn ein Gericht es verlangt.
Beweise lassen sich sichern, Wallets identifizieren, Täter verfolgen.
Und: Gerichte akzeptieren mittlerweile, dass Plattformen nicht völlig haftungsfrei sind – wer prüft, wann gehandelt werden muss, wird belohnt.
Kurz gesagt:
Wer die Beweiskette „Täuschung – Zahlung – Plattform“ sauber dokumentiert und juristisch konsequent verfolgt, hat reale Erfolgsaussichten – sei es durch Urteil oder stillen Vergleich. Entscheidend ist, dass Sie klagen – nicht warten. Denn erst dann beginnt sich der Fall zu drehen.
📞 Kostenlose Ersteinschätzung
Sie möchten Crypto.com, Binance oder eine andere Krypto-Plattform verklagen?
Wir prüfen Ihren Fall vertraulich und individuell.
📩 Jetzt Kontakt aufnehmen
📞 0160 9955 5525
Anwaltlicher Überblick zu Krypto-Betrug: Ihre Rechte als Opfer
Krypto-Betrug hat sich zu einem der komplexesten und am schnellsten wachsenden Betrugsphänomene der letzten Jahre entwickelt. Als auf Finanz- und IT-Recht spezialisierte Kanzlei beraten wir geschädigte Anleger bei der zivilrechtlichen Rückforderung, strafrechtlichen Anzeige sowie der Haftung von Plattformen und Vermittlern. Nachfolgend finden Sie eine Auswahl vertiefender Fachbeiträge zu verschiedenen Aspekten des Krypto-Betrugs – von Blockchain-Spurensuche bis zur Haftung internationaler Börsen.
- Adhäsionsverfahren und Schadensersatz im Krypto-Betrugsfall
https://www.hortmannlaw.com/articles/adhasionsverfahren-und-schadensersatz-im-krypto-betrugsfall - Die Rolle von Smart Contracts im Krypto-Betrug: Sicherheitslücken und rechtliche Risiken
https://www.hortmannlaw.com/articles/die-rolle-von-smart-contracts-im-krypto-betrug - Einführung in den Krypto-Betrug: Typologien und Vorgehensweisen
https://www.hortmannlaw.com/articles/einfuhrung-in-den-krypto-betrug-typologien-und-vorgehensweisen - Fake "Cryptotaskforce" - Funds Recovery Services – Hilfe nach Krypto Betrug?
https://www.hortmannlaw.com/articles/recovery-service-betrug - Geldwäsche-Verdacht Krypto Betrug
https://www.hortmannlaw.com/articles/geldwasche-verdacht-krypto-betrug - Konto gesperrt, Krypto-Betrug
https://www.hortmannlaw.com/articles/konto-gesperrt-krypto-betrug - Krypto Betrug & Blockchain-Tracing – Anwalt verfolgt Bitcoin- und Ethereum-Spuren für Opfer
https://www.hortmannlaw.cBitte die nächsten 37 in genau dem Stilom/articles/krypto-betrug-blockchain-tracing-opfer-anwalt - Krypto Betrug & FIU-Meldung – Anwalt begleitet Opfer bei Verdachtsanzeigen Geldwäsche
https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-fiu-meldung-opfer-anwalt - Krypto Betrug & Recovery-Scams – Anwalt schützt Bitcoin- und Ethereum-Opfer vor neuem Verlust
https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-recovery-scams-opfer-anwalt - Krypto Betrug & Wallet-Beweise – Anwalt erklärt Opfern, wie Bitcoin- und SEPA-Spuren wirken
https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-wallet-beweise-opfer-anwalt - Krypto Betrug & zivilrechtlicher Regress – Anwalt holt für Opfer Bitcoin- und Ethereum-Verluste zurück
https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-zivilrechtlicher-regress-opfer-anwalt - Krypto Betrug über DEX, Bridges & Mixer – Anwalt schützt Bitcoin- und Ethereum-Opfer
https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-dex-bridges-mixer-opfer-anwalt - Krypto Betrug: Beweissicherung und Spurensuche auf der Blockchain
https://www.hortmannlaw.com/articles/beweissicherung-krypto-betrug - Krypto Betrug: Finanzaufsicht und Haftung – Warum die BaFin oft zu spät reagiert
https://www.hortmannlaw.com/articles/bafin-haftung-krypto-betrug - Krypto Betrug: Internationale Geldwäscheketten – Wie Täter Spuren verschleiern
https://www.hortmannlaw.com/articles/geldwaescheketten-krypto-betrug - Krypto Betrug: Rückbuchung nach Krypto-Transfer – Gibt es eine rechtliche Chance?
https://www.hortmannlaw.com/articles/rueckbuchung-krypto-transfer - Krypto-Address-Hijacking – Falsche Wallet-Adressen und Blockchain-Beweisführung
https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-address-hijacking - Krypto-Betrug und Rückzahlung – steuerliche Behandlung von Recovery-Geldern
https://www.hortmannlaw.com/articles/steuerliche-behandlung-recovery-gelder - Krypto-Betrug via WhatsApp, Telegram & Co.
https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-via-whatsapp-telegram-co-ratgeber-fur-betroffene - Recovery Scams nach Krypto-Betrug – Die zweite Täuschungswelle
https://www.hortmannlaw.com/articles/recovery-scam-krypto-betrug - SCHUFA Eintrag Krypto Betrug
https://www.hortmannlaw.com/articles/schufa-eintrag-krypto-betrug - Steuern Krypto Betrug Verluste
https://www.hortmannlaw.com/articles/steuern-krypto-betrug-verluste - Strafanzeige Krypto Betrug
https://www.hortmannlaw.com/articles/strafanzeige-krypto-betrug - AGB im Krypto-Handel – Verantwortung der Plattformen und Grenzen der Haftung
https://www.hortmannlaw.com/articles/agb-krypto-plattform-verantwortung-haftung - Binance Steuerfahndung Krypto-Wallets
https://www.hortmannlaw.com/articles/binance-steuerfahndung-krypto-wallets - Crypto.com, OpenPayd, Foris MT und ihre Verantwortung bei Krypto-Betrug
https://www.hortmannlaw.com/articles/die-plattformstruktur-hinter-crypto-com-openpayd-und-foris-mt-hintergrunde-pflichten-und-ihre-rechte - DAC7 und DAC8 - Meldepflichten für Krypto und Plattformen - Neue Transparenzregeln
https://www.hortmannlaw.com/articles/dac7-und-dac8-meldepflichten-fur-krypto-und-plattformen-neue-transparenzregeln - DSGVO - Auskunftsrecht, Löschpflicht und Haftungsrisiken für Unternehmen
https://www.hortmannlaw.com/articles/dsgvo-auskunftsrecht-loschpflicht-und-haftungsrisiken-fur-unternehmen - DSGVO und Crypto.com – Pflichten bei Krypto-Betrug und Datenzugriff
https://www.hortmannlaw.com/articles/dsgvo-crypto-com-pflichten-krypto-betrug - Datenauskunft nur mit Konzept
https://www.hortmannlaw.com/articles/datenauskunft-nur-mit-konzept - Die Rolle von Krypto-Plattformen im Zusammenhang mit der DSGVO: Datenschutzverletzungen und Haftung
https://www.hortmannlaw.com/articles/die-rolle-von-krypto-plattformen-im-zusammenhang-mit-der-DSGVO - Digitales Urheberrecht: Upload-Filter, NFTs und KI-generierte Inhalte
https://www.hortmannlaw.com/articles/digitales-urheberrecht-upload-filter-nfts-und-ki-generierte-inhalte - Einkommensteuer, § 23 EStG, Krypto-Gewinne, Krypto-Verluste, Haltefrist, Freigrenze, Staking, Lending, Dokumentationspflichten, Verluste durch Betrug, Hacks
https://www.hortmannlaw.com/articles/einkommensteuer-ss-23-estg-krypto-gewinne-krypto-verluste-haltefrist-freigrenze-staking-lending-dokumentationspflichten-verluste-durch-betrug-hacks - Klage gegen Crypto.com & Co: Wie Opfer von Krypto-Betrug, Bitcoin- und Love-Scam-Fällen vor Gericht Erfolg haben
https://www.hortmannlaw.com/articles/klage-gegen-crypto-com-plattform-betrug - Klage gegen die Bank bei Love-Scam, Krypto- und Anlagebetrug – Gerichtspraxis statt Theorie
https://www.hortmannlaw.com/articles/klage-gegen-die-bank-betrug - Krypto Betrug: Crypto.com wusste Bescheid – Pflichtverletzung bei Scam-Flags und Untätigkeit
https://www.hortmannlaw.com/articles/crypto-com-scam-flags-pflichtverletzung - Krypto Betrug: Custodial vs. Non-Custodial Wallets – Haftung im Vergleich - Anwalt erklärt
https://www.hortmannlaw.com/articles/custodial-non-custodial-wallet-haftung - Krypto Betrug: Datenlecks auf Plattformen – Wenn Sicherheit zum Risiko wird
https://www.hortmannlaw.com/articles/datenlecks-krypto-betrug - Krypto Betrug: Schadensersatzklagen gegen ausländische Plattformen
https://www.hortmannlaw.com/articles/schadensersatz-ausland-krypto - Krypto Betrug: Strafanzeige gegen Plattformen (z.B. Crypto.com) – Chancen und Grenzen der Strafverfolgung
https://www.hortmannlaw.com/articles/strafanzeige-krypto-plattform - Krypto-Betrug bei Crypto.com – Die Illusion der Kontrolle in den AGB
https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-crypto-com-illusion-kontrolle - Krypto-Verluste und Betrugsfälle - Tücken bei privaten Veräußerungen
https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-verluste-und-betrugsfalle-tucken-bei-privaten-verausserungen - Love Scam und Crypto.com – Haftet die Plattform trotz AGB? Anwalt hilft Opfern
https://www.hortmannlaw.com/articles/love-scam-crypto-com-haftung-agb - Mietzins, Indexklauseln und Anpassungen – Wo digitale Änderungen die Form sprengen
https://www.hortmannlaw.com/articles/schriftform-indexklausel-digitale-aenderung - Projekt 370 Special – DAC8, Geldwäsche und die Zukunft der internationalen Steuerhinterziehung
https://www.hortmannlaw.com/articles/explore-the-matrix-zur-risikoprufung-von-dac8 - Schadensersatz bei verweigerter oder verzögerter Auskunft – Crypto.com
https://www.hortmannlaw.com/articles/schadensersatz-bei-verweigerter-oder-verzogerter-datenschutzauskunft---crypto-com - Steuerliche Implikationen von Krypto-Betrug: Steuerhinterziehung und Steuerverkürzung durch betrügerische Transaktionen
https://www.hortmannlaw.com/articles/steuerliche-implikationen-von-krypto-betrug
Love Scamming, Romance Fraud & digitale Beziehungstäuschung – Rechtlicher Überblick
Digitale Liebesmaschen wie Love Scams, Romance Fraud oder manipulatives Sugar Dating betreffen jährlich tausende Menschen. Oft geht es nicht nur um emotionale Täuschung, sondern um erhebliche finanzielle Schäden, psychologische Abhängigkeit oder sogar Erpressung. Unsere Kanzlei berät Opfer umfassend zu zivilrechtlichen Ansprüchen, Strafanzeigen und der Haftung von Plattformen. Nachfolgend finden Sie Fachbeiträge zu den wichtigsten Aspekten – von Deepfakes und Chatbots bis zu Rückforderungsansprüchen und Recovery Scams.
- Honey-Trap 2.0 – The Times, NDTV und andere Medien warnen vor neuer Form digitaler Spionage
https://www.hortmannlaw.com/articles/honey-trap-sex-warfare-the-times-ndtv-digitale-spionage-europa - Klage bei Täuschung im Sugar-Dating – Wann Sie rechtlich gegen Fake-Beziehungen vorgehen können
https://www.hortmannlaw.com/articles/klage-sugar-dating-betrug - Love Scam und Krypto-Transfers – Wenn Fake-Liebe zur Wallet führt
https://www.hortmannlaw.com/articles/love-scam-und-krypto-transfers---wenn-fake-liebe-zur-wallet-fuhrt - Love Scam und Opferrechte – Schadensersatz, Nebenklage, psychologische Hilfe
https://www.hortmannlaw.com/articles/love-scam-opferrechte-anwalt - Love Scam und Plattformhaftung – Verantwortung sozialer Netzwerke
https://www.hortmannlaw.com/articles/love-scam-plattformhaftung-opfer-anwalt - Love Scam und Steuern – Geldwäschefallen und steuerliche Risiken richtig vermeiden
https://www.hortmannlaw.com/articles/love-scam-steuern-und-geldwaesche - Love Scam und Versicherungen RSV – Wann keine Schadensdeckung besteht
https://www.hortmannlaw.com/articles/love-scam-und-versicherungen-rsv---wann-keine-schadensdeckung-besteht - Love Scam und psychologische Manipulation – Zwischen Einwilligung und Täuschung
https://www.hortmannlaw.com/articles/love-scam-psychologische-manipulation-opfer-anwalt - Love Scam: Deepfake-Romantik – Virtuelle Gesichter, reale Täuschung
https://www.hortmannlaw.com/articles/deepfake-romantik - Love Scam: Internationale Strafverfolgung – Grenzen der Ermittlungen
https://www.hortmannlaw.com/articles/internationale-strafverfolgung-love-scam - Love Scam: Künstliche Intelligenz und Chatbots als Täuschungswerkzeug
https://www.hortmannlaw.com/articles/ki-love-scam - Love Scam: LinkedIn als neue Falle – Wenn Business zu Nähe wird
https://www.hortmannlaw.com/articles/love-scam-linkedin - Love Scam: Opfer mit Status – Warum Akademiker besonders gefährdet sind
https://www.hortmannlaw.com/articles/love-scam-akademiker - Love Scam: Psychologische Abhängigkeit und finanzielle Kontrolle
https://www.hortmannlaw.com/articles/psychologische-abhaengigkeit-love-scam - Love Scam: Romance Fraud 2025 – Neue Tätergruppen und Plattformen
https://www.hortmannlaw.com/articles/romance-fraud-2025 - Love Scam: Sextortion – Digitale Erpressung nach Beziehungsende
https://www.hortmannlaw.com/articles/sextortion-love-scam - Love oder Romance Scamming – Digitale Täuschung mit Gefühl - Anwalt hilft Opfern
https://www.hortmannlaw.com/articles/love-scamming---digitale-tauschung-mit-gefuhlq - MySugardaddy Betrug mit Vorauszahlung – PayPal, Amazon-Gutschein oder Sofortüberweisung erkennen
https://www.hortmannlaw.com/articles/mysugardaddy-betrug-vorauszahlung-paypal-amazon-sofortueberweisung - MySugardaddy – Körperlicher Kontakt & Abenteuer/Spaß gegen Geld-TG oder Darlehen: Wann Geld zurückgefordert werden kann
https://www.hortmannlaw.com/articles/mysugardaddy-tg-darlehen-rueckforderung-geld - Recovery Scam nach Love Scam – Wenn Opfer erneut betrogen werden
https://www.hortmannlaw.com/articles/recovery-scam-love-scam - Scamming: PayPal-Betrug und Dating-Scams
https://www.hortmannlaw.com/articles/paypal-betrug-und-dating-scams - Sugar-Dating Erpressung
https://www.hortmannlaw.com/articles/sugar-erpressung
Anlagebetrug
Ob vermeintlich seriöse Trading-Plattform, betrügerische Broker-App oder raffinierte Lockvogel-Taktik: Anlagebetrug nimmt viele Formen an – das Ergebnis ist oft dasselbe: hohe Verluste, gebrochene Versprechen und kein Ansprechpartner mehr. Wir helfen Betroffenen, ihre rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen, Ansprüche durchzusetzen und weitere Schäden zu verhindern. Wer früh reagiert, erhöht die Chance, Vermögenswerte zu sichern oder zurückzuholen.
- Schwarze Liste betrügerischer Plattformen (aktualisiert: Oktober 2025)
https://www.hortmannlaw.com/articles/schwarze-liste-betrugerischer-plattformen - Anlagebetrug durch Fake-Profile – wenn Vertrauen gezielt missbraucht wird
https://www.hortmannlaw.com/articles/anlagebetrug-fake-profile-vertrauen-missbrauch - Anlagebetrug durch Lockvögel – Wie Täter Vertrauen durch Chatkontakte erschleichen
https://www.hortmannlaw.com/articles/anlagebetrug-lockvoegel-vertrauen-chatkontakte - Anlagebetrug in Messenger-Gruppen – Die Macht der Schein-Community
https://www.hortmannlaw.com/articles/anlagebetrug-whatsapp-gruppen-social-proof-taktiken - Anlagebetrug über Fake-Trading-Apps – Virtuelle Depots, reale Verluste
https://www.hortmannlaw.com/articles/anlagebetrug-fake-trading-apps-virtuelle-depots - Anlagebetrug: Gefälschte Kreditrahmen – Wie Betrüger mit Fake-Plattformen neue Zahlungen erzwingen
https://www.hortmannlaw.com/articles/gefaelschte-kredite-anlagebetrug-virtuelle-kreditrahmen - Anlagebetrug: Geldflüsse – Internationale Überweisungen als Spur
https://www.hortmannlaw.com/articles/geldfluesse-anlagebetrug-internationale-ueberweisungen - Anlagebetrug: Psychologie digitaler Betrugsnetzwerke – Manipulation in WhatsApp-Gruppen
https://www.hortmannlaw.com/articles/psychologie-digitaler-betrugsnetzwerke-whatsapp-gruppen - Anlagebetrug: TaktikInvest Allianz & Clearstream Fake – neue Betrugsmasche über Finanzen.net
https://www.hortmannlaw.com/articles/taktikinvest-allianz-clearstream-finanzen-net-betrug
Plattformhaftung
Online-Plattformen wie Crypto-Börsen, Zahlungsdienstleister oder Vermittlungsportale tragen Mitverantwortung, wenn Nutzer geschädigt werden – etwa durch betrügerische Angebote, Sicherheitslücken oder unterlassene Warnungen. Immer mehr Gerichte erkennen in solchen Fällen eine Haftung der Anbieter. Wir setzen uns dafür ein, dass Plattformen nicht nur von Transaktionen profitieren, sondern auch Verantwortung übernehmen – und helfen Betroffenen, ihre Rechte konsequent geltend zu machen.
- AGB im Krypto-Handel – Verantwortung der Plattformen und Grenzen der Haftung
https://www.hortmannlaw.com/articles/agb-krypto-plattform-verantwortung-haftung - Bankhaftung bei Onlinebetrug – Wann Sie Ihr Geld zurückfordern können
https://www.hortmannlaw.com/articles/haftung-der-bank-bei-onlinebetrug - DSGVO und Crypto.com – Pflichten bei Krypto-Betrug und Datenzugriff
https://www.hortmannlaw.com/articles/dsgvo-crypto-com-pflichten-krypto-betrug - Klage gegen die Bank bei Love-Scam, Krypto- und Anlagebetrug – Gerichtspraxis statt Theorie
https://www.hortmannlaw.com/articles/klage-gegen-die-bank-betrug - Love Scam und Crypto.com – Haftet die Plattform trotz AGB? Anwalt hilft Opfern
https://www.hortmannlaw.com/articles/love-scam-crypto-com-haftung-agb
Das könnte Sie auch interessieren
Entdecken Sie weitere Beiträge zu aktuellen Themen rund um Digitalrecht, Cybercrime, Datenschutz, KI und Steuerrecht. Unsere verwandten Artikel geben Ihnen zusätzliche Einblicke und vertiefende Analysen.

.jpg)
Krypto Betrug Geld zurück? Binance, Crypto.com, Coinbase – Chancen, Freeze, rechtliche Schritte
Nach einem Krypto-Betrug ist das Vermögen nicht automatisch verloren. Der Beitrag erklärt, wann Börsen wie Binance, Crypto.com oder Coinbase eingebunden werden können, welche Sicherungsmaßnahmen realistisch sind und welche Versprechen unseriös sind.

.jpg)
Trade Republic Krypto Betrug – Geld weg nach Phishing? Haftung, Warnpflichten, was möglich ist
Immer häufiger erfolgen Krypto-Verluste über bekannte Broker wie Trade Republic. Dieser Beitrag beleuchtet typische Betrugsmuster, auffällige Transaktionen und die Frage, wann Warn- oder Interventionspflichten des Brokers rechtlich relevant werden können.

.jpg)
Krypto Konto gehackt – fremder Login, Datenleck oder Phishing? Anwalt klärt Zugriff und Haftung
Nach einem Krypto-Betrug stellt sich die zentrale Frage, wie Täter Zugriff erlangen konnten. Der Beitrag zeigt, wie Login-Daten, Geräte, IP-Zugriffe und mögliche Datenlecks rechtlich überprüft werden können und warum die Ursachenklärung entscheidend für Haftungsfragen ist.
Suchen Sie dringend diskrete, juristische Unterstüzung?
Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter – schildern Sie uns Ihr Anliegen und wir finden gemeinsam eine Lösung.