Wasserschäden durch Nachbarn – wer haftet wirklich? Anwalt erklärt


Juristische Expertise
- Cybercrime & Krypto-Betrug
- AI & Zukunftsrecht
- Steuerrecht & Steuerstrafrecht
- Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht & Zivilrecht
- Datenschutz & Digitalrecht
Wasserschäden durch Nachbarn – wer haftet wirklich?
Verfasst von Rechtsanwalt Max Nikolas Mischa Hortmann, Frankfurt am Main – Vertragsautor jurisAZO-ITR / PR-ITR
Wenn Wasser vom Nachbargrundstück kommt
Wasser macht nicht an der Grundstücksgrenze halt.
Ein geplatztes Rohr, eine undichte Dachrinne oder ein überlaufender Gartenteich – schon steht der Keller unter Wasser.
Wer dann haftet, ist für viele Eigentümer unklar.
Das Nachbarrecht zieht die Grenze zwischen unvermeidlicher Naturgewalt und nachlässiger Pflichtverletzung.
Dieser Beitrag erklärt praxisnah, wann Nachbarn für Wasserschäden einstehen müssen,
wie die Beweislage aussieht und welche Versicherungen helfen.
1. Rechtliche Grundlagen – BGB und Nachbarrecht
Im Kern geht es um zwei Vorschriften:
§ 823 BGB (Schadensersatzpflicht) und § 906 BGB analog (nachbarrechtlicher Ausgleichsanspruch).
Nach § 823 BGB haftet derjenige, der vorsätzlich oder fahrlässig das Eigentum eines anderen verletzt.
Das gilt für Leitungswasser, das aus defekten Rohren austritt,
ebenso wie für Regen- oder Oberflächenwasser, das durch fehlerhafte Anlagen auf das Nachbargrundstück gelangt.
Ist kein Verschulden nachweisbar, kann dennoch ein Ausgleichsanspruch bestehen.
§ 906 Abs. 2 S. 2 BGB analog gleicht rechtmäßige, aber unzumutbare Einwirkungen aus.
So wird verhindert, dass ein Geschädigter leer ausgeht, obwohl der Nachbar alles richtig gemacht hat.
2. Wann der Nachbar haftet
Ein Nachbar haftet immer dann, wenn sein Verhalten oder seine Anlagen ursächlich für den Wasserschaden waren und er die Sorgfaltspflichten verletzt hat.
Fahrlässig handelt, wer erkennbare Risiken ignoriert oder notwendige Wartungen unterlässt.
Typische Fälle sind:
- Leitungen, die bei Frost nicht entleert oder isoliert wurden,
- Dachrinnen, die seit Jahren verstopft sind,
- Teiche oder Pools ohne Überlauf,
- Drainagen, die Wasser gezielt auf das Nachbargrundstück ableiten,
- Bauarbeiten, bei denen Abdichtungen fehlen.
Der Eigentümer eines Grundstücks ist verpflichtet, seine Anlagen so zu unterhalten, dass keine Gefahren für andere entstehen.
Das umfasst Gebäude, Leitungen, Regenrinnen, Grundleitungen, Zisternen, Gartenteiche und Bewässerungsanlagen.
3. Wann keine Haftung besteht
Nicht jeder Schaden ist ersatzfähig.
Wenn extreme Naturereignisse – etwa ein Jahrhunderthochwasser oder ein Starkregen, der jedes Abflusssystem überfordert – das Wasser über die Grundstücksgrenze drücken, liegt höhere Gewalt vor.
Auch wenn der Geschädigte selbst Mitverschulden trägt, etwa durch offene Kellerfenster, defekte Abdichtung oder fehlende Rückstauklappe, mindert das oder schließt den Anspruch aus.
Das Recht verlangt, dass jeder Eigentümer angemessene Schutzmaßnahmen trifft, um sein Grundstück vor vorhersehbaren Risiken zu sichern.
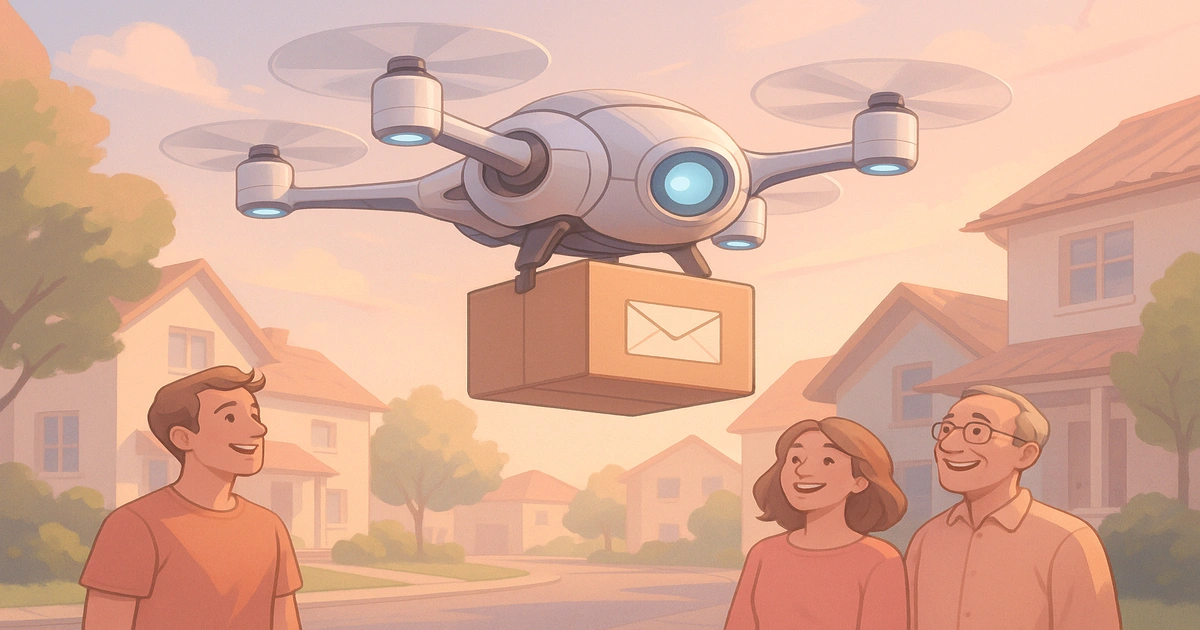
4. Typische Konstellationen in der Praxis
Ein Klassiker ist der defekte Außenwasserhahn.
Wird er im Winter nicht entleert, platzt das Rohr, und das austretende Wasser fließt in den Keller des Nachbarn.
Hier liegt Fahrlässigkeit vor – der Nachbar haftet vollumfänglich.
Ebenso haftet, wer eine undichte Dachrinne jahrelang ignoriert, obwohl sie regelmäßig überläuft.
Bei Starkregen dringt das Wasser durch die Fassade des Nachbarn – auch hier greift § 823 BGB.
Anders ist es, wenn trotz einwandfreier Wartung eine Leitung plötzlich ohne Vorwarnung bricht.
In diesem Fall fehlt das Verschulden.
War die Anlage fachgerecht installiert und regelmäßig überprüft, kann der Eigentümer den Schaden nicht verhindern.
Dann bleibt der Geschädigte nur mit dem Ausgleichsanspruch, nicht mit vollem Schadensersatz.
Ein weiteres Beispiel:
Ein Grundstück liegt leicht erhöht, das Gefälle führt natürlich auf das Nachbargrundstück.
Verändert der obere Eigentümer das Gelände, etwa durch Aufschüttung oder Pflasterarbeiten, und leitet dadurch mehr Oberflächenwasser ab, muss er dafür einstehen.
Wasser, das durch menschliche Gestaltung übertritt, gilt nicht mehr als „natürlicher Abfluss“.
5. Der nachbarrechtliche Ausgleichsanspruch
Der Ausgleichsanspruch nach § 906 BGB analog ist ein gerechter Mittelweg zwischen Duldung und voller Haftung.
Er greift, wenn keine Pflichtverletzung vorliegt, der Schaden aber dennoch erheblich ist.
Beispiel:
Ein moderner Neubau verfügt über eine normgerechte Drainage.
Nach Starkregen drückt Wasser durch den Boden und flutet das benachbarte Kellerabteil.
Der Bauherr hat alles richtig gemacht – dennoch entsteht ein Schaden.
In solchen Fällen kann der betroffene Nachbar eine angemessene Geldentschädigung verlangen.
Der Ausgleichsanspruch soll den Eigentümer nicht bestrafen, sondern den Geschädigten wirtschaftlich so stellen, als hätte die Beeinträchtigung nicht stattgefunden.
6. Beweis und Dokumentation
Wasser verschwindet, bevor die juristische Klärung beginnt.
Darum ist schnelle Beweissicherung entscheidend.
Unmittelbar nach dem Schaden sollten Sie:
- den Zustand fotografieren (Pfützen, Laufwege, durchnässte Wände),
- Zeugen festhalten (Nachbarn, Handwerker, Feuerwehr),
- die Schadenszeit und Witterung notieren,
- das Ausmaß der Durchfeuchtung dokumentieren (Messgerät, Handwerkerbericht).
Bei komplexeren Fällen empfiehlt sich ein Privatgutachten, um Ursache, Eintrittsweg und Schadenshöhe festzuhalten.
Bei hohen Beträgen oder unklarer Ursache ist ein gerichtliches Beweissicherungsverfahren sinnvoll.
Es schafft gerichtsfeste Grundlagen für spätere Klagen oder Versicherungsregulierung.
7. Versicherungen und Regress
Ein Wasserschaden betrifft fast immer mehrere Versicherungen gleichzeitig.
- Wohngebäudeversicherung: ersetzt Schäden am Baukörper, etwa nasse Wände oder Böden.
- Hausratversicherung: deckt bewegliche Gegenstände ab.
- Privathaftpflicht oder Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht: springt ein, wenn Sie selbst den Schaden verursachen.
- Bauherren-Haftpflicht: schützt bei Bauprojekten gegen Wasseraustritte oder Drainagefehler.
Wichtig ist, dass Versicherungen nur zahlen, wenn die Ursache im versicherten Risiko liegt.
Ist das Ereignis ausgeschlossen oder grob fahrlässig herbeigeführt, kann die Leistung gekürzt werden.
Hat Ihre eigene Versicherung gezahlt, kann sie Regress beim Nachbarn nehmen.
Für Sie ist das unproblematisch – die Versicherer klären die Haftungsfrage untereinander.
8. Umgang mit dem Nachbarn
Wasserschäden sind emotional.
Bleiben Sie sachlich und dokumentieren Sie alles schriftlich.
- Sofort informieren: Teilen Sie dem Nachbarn den Schaden mit und bitten Sie um Klärung.
- Schriftliche Aufforderung: Setzen Sie eine Frist, um die Ursache zu beseitigen.
- Gemeinsame Klärung: Oft genügt ein Installateur oder Dachdecker, um den Fehler zu finden.
- Anwalt einschalten: Wenn der Nachbar abstreitet oder nicht reagiert, übernehmen wir die Kommunikation – professionell und sachlich.
Ziel ist nicht Streit, sondern die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands.
9. Schadensersatz und Umfang
Ersatzfähig sind alle unmittelbaren und mittelbaren Schäden,
also die Kosten für:
- Trocknung, Sanierung und Wiederherstellung,
- beschädigte Möbel oder Technik,
- Gutachter und Handwerker,
- Mietausfälle, wenn Räume unbewohnbar sind,
- und in Ausnahmefällen auch immaterielle Schäden (etwa Gesundheitsfolgen).
Die Höhe richtet sich nach dem tatsächlichen Schaden, nicht nach Pauschalen.
Bei Verzug kann zusätzlich Verzugszinsen und Anwaltskosten verlangt werden.
10. Abwehr unberechtigter Forderungen
Manchmal versucht ein Nachbar, Sie für Schäden verantwortlich zu machen,
die gar nicht von Ihrem Grundstück stammen.
Dann gilt: Keine Anerkenntnisse abgeben, keine vorschnellen Zahlungen leisten.
Lassen Sie prüfen,
- ob das Wasser tatsächlich von Ihrem Grundstück kam,
- ob Ihre Anlagen fehlerhaft waren,
- und ob das Ereignis überhaupt vermeidbar war.
Oft ist das Regenwasser kommunaler Natur –
dann haftet nicht der Eigentümer, sondern gegebenenfalls die Gemeinde,
wenn die Kanalisation überlastet oder defekt war.
11. Öffentlich-rechtliche Aspekte
Manche Schäden entstehen durch fehlende Entwässerungsplanung oder baurechtliche Verstöße.
Wer auf seinem Grundstück so baut, dass Niederschlag gezielt zum Nachbarn geleitet wird,
verstößt gegen das Abflussgebot und kann behördlich verpflichtet werden, die Anlage zu ändern.
Die Bauaufsicht kann Maßnahmen anordnen oder den Rückbau verlangen,
wenn der Wasserabfluss Gefahren für benachbarte Grundstücke verursacht.
12. Prävention – so vermeiden Sie Konflikte
- Regelmäßig prüfen: Dachrinnen, Fallrohre, Leitungen und Pumpen jährlich kontrollieren.
- Frostschutz: Außenleitungen entleeren und absperren.
- Rückstauklappe: gegen Abwasserübertritt aus dem Kanal.
- Geländegefälle: so gestalten, dass Wasser ins eigene Grundstück abfließt.
- Transparente Kommunikation: Nachbarn informieren, wenn Bauarbeiten oder Veränderungen am Gelände anstehen.
Wer vorsorgt, spart am Ende Zeit, Geld und Nerven.
13. Beispiel aus der Praxis
Ein Hauseigentümer ließ in seinem Garten einen Zierteich anlegen.
Nach einem Starkregen überlief der Teich und setzte das Nachbargrundstück unter Wasser.
Das Gericht entschied: Der Eigentümer haftet,
weil er keinen funktionierenden Überlauf installiert und die Gefahr vorhersehen konnte.
In einem anderen Fall führte eine geplatzte Heizungsleitung im Obergeschoss zur Durchfeuchtung der Wohnung darunter.
Der Bewohner hatte die Anlage nicht gewartet – klare Fahrlässigkeit, volle Haftung.
Diese Fälle zeigen:
Sorgfaltspflichten enden nicht an der Wand, sondern an der Ursache.

Wasserschaden, Nachbar, Haftung, § 823 BGB, Ausgleichsanspruch, Rohrbruch, Regenwasser, Schadenersatz
Fazit: Wasser ist unberechenbar – Verantwortung nicht
Wasserschäden sind teuer, unangenehm und oft vermeidbar.
Das Nachbarrecht stellt sicher, dass niemand die Folgen fremder Nachlässigkeit tragen muss.
Wer seine Anlagen pflegt, haftet nicht.
Wer sie vernachlässigt, schon.
Und wer unverschuldet betroffen ist, kann trotzdem Ausgleich verlangen.
Die wichtigste Regel lautet: Dokumentieren, handeln, beraten lassen.
Jetzt rechtliche Einschätzung sichern
Sie haben einen Wasserschaden durch den Nachbarn oder sollen für einen solchen haften?
Ich prüfe die Ursachen, kläre die Haftungsfrage und vertrete Sie konsequent gegenüber Nachbarn, Versicherern oder Bauunternehmen.
🔗 Cluster: Immobilien- und Nachbarschaftsrecht
1. Überhängende Äste – wann darf man sie abschneiden?
Rechte und Pflichten bei überhängenden Zweigen, Fristen, Selbsthilferecht und Nachbarpflichten.
2. Überbau und Grenzbebauung – was tun, wenn der Nachbar zu weit gebaut hat?
Wann besteht eine Duldungspflicht, wann Anspruch auf Rückbau oder Entschädigung?
3. Nachbarschaftslärm – welche Geräusche müssen Sie dulden?
Rechte bei Lärm durch Nachbarn, Ruhezeiten und Möglichkeiten zur Unterlassung.
4. Grenzbepflanzung und Hecken – was das Nachbarschaftsrecht erlaubt
Zulässige Höhen, Abstände und Rückschnittrechte im Landesnachbarrecht.
5. Kameraüberwachung im Garten – Datenschutz unter Nachbarn
Wann private Videoüberwachung erlaubt ist und wie das Persönlichkeitsrecht geschützt bleibt.
6. Baumängel am Nachbarhaus – wann haftet der Bauherr?
Haftung, Beweisführung und Schadensersatz bei Baumängeln durch Nachbarbau.
7. Baulärm und Schadensersatz – wann Sie Anspruch auf Ruhe haben
Grenzen der Zumutbarkeit, Ausgleichsanspruch und rechtliche Schritte bei Dauerlärm.
8. Eigentumsgrenzen und Vermessungsfehler – wer trägt die Kosten?
Rechte bei falschen Grenzverläufen, Katasterberichtigung und Grenzfeststellung.
9. ANWALT.DE Teil
Teil der Serie auf Anwalt.de
10. Nachbarschaftsstreit – Mediation, Klage und Vergleich
Wie Sie Konflikte rechtssicher und außergerichtlich lösen, bevor sie eskalieren.
Das könnte Sie auch interessieren
Entdecken Sie weitere Beiträge zu aktuellen Themen rund um Digitalrecht, Cybercrime, Datenschutz, KI und Steuerrecht. Unsere verwandten Artikel geben Ihnen zusätzliche Einblicke und vertiefende Analysen.

.jpg)
Die digitale Aktie 2025: Anwalt erklärt Tokenisierung, eWpG, MiCA-Abgrenzung & Kapitalmarktpflichten
Digitale Aktien und Security Tokens werden durch eWpG, MiFID II und technische Registersysteme zu vollwertigen Kapitalmarktinstrumenten. Dieser Aufsatz zeigt Startups und Emittenten, wie Tokenisierung funktioniert, wie Security Tokens von MiCA-Kryptoassets abzugrenzen sind und welche Chancen, Risiken und Compliance-Pflichten damit verbunden sind.

.jpg)
Krypto Betrug, Anlagebetrug & Love Scam – Domatik Transaktionsmuster, Haftung Bank und Wege zum Geld zurück (Teil 1 der Muster-Serie)
Transaktionsmuster gehören zu den zentralen juristischen Nachweispunkten im Krypto Betrug. Banken müssen auffällige, atypische oder risikobehaftete Zahlungsabläufe erkennen, prüfen und gegebenenfalls stoppen. Wenn diese Pflicht verletzt wird, kann die Bank trotz TAN-Eingaben oder Kundenbestätigungen haften. Dieser Artikel erklärt, wie Transaktionsmuster technisch entstehen, wie sie forensisch gesichert werden und warum sie bei Krypto Betrug, Anlagebetrug und Love Scam die stärksten Hebel für Schadensersatz und „Geld zurück“-Ansprüche gegen Banken und Zahlungsdienstleister sind.

.jpg)
Nachbarschaftsstreitigkeiten beilegen – Mediation und gerichtliche Wege - Anwalt hilft
Bevor der Konflikt eskaliert, lohnt sich Mediation. Der Beitrag zeigt außergerichtliche Lösungswege, wann Klage sinnvoll ist und wie gerichtliche Vergleiche Kosten sparen.
Suchen Sie dringend diskrete, juristische Unterstüzung?
Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter – schildern Sie uns Ihr Anliegen und wir finden gemeinsam eine Lösung.