DSGVO-Einwilligung unter Druck: Unzulässige Kopplungen erkennen


Juristische Expertise
- Cybercrime & Krypto-Betrug
- AI & Zukunftsrecht
- Steuerrecht & Steuerstrafrecht
- Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht & Zivilrecht
- Datenschutz & Digitalrecht
Einwilligung unter Druck: Unzulässige Kopplungen, strukturelle Abhängigkeiten und die Anforderungen an Freiwilligkeit nach Art. 6 und 7 DSGVO
I. Einleitung: Die Einwilligung als sensibelste Rechtsgrundlage der DSGVO
Die Einwilligung ist eine der zentralen Rechtsgrundlagen der DSGVO, aber zugleich die anfälligste für Fehlanwendungen. Sie soll Ausdruck einer freien, informierten und freiwilligen Entscheidung sein. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass Einwilligungen häufig unter Bedingungen eingeholt werden, die eine echte Entscheidungsfreiheit in Frage stellen. Die DSGVO regelt dies eng: Art. 6 Abs. 1 lit. a verlangt eine wirksame Einwilligung, Art. 7 konkretisiert die Anforderungen, und Erwägungsgrund 43 stellt klar, dass Einwilligungen dann nicht freiwillig sind, wenn faktische Abhängigkeiten bestehen.
Mehrere Gerichte und Aufsichtsbehörden betonen, dass Drucksituationen, implizite Erwartungen oder organisatorische Hürden die Wirksamkeit einer Einwilligung infrage stellen. Die Rechtsprechung — darunter Entscheidungen aus dem arbeitsrechtlichen Bereich, aber auch allgemeine verwaltungsgerichtliche und zivilgerichtliche Linienstellungen — zeigt, dass die Freiwilligkeit bereits dann nicht mehr vorliegt, wenn Betroffene annehmen müssen, dass ihre Entscheidung Nachteile auslöst.
Damit ist die Frage unzulässiger Kopplungen nicht nur ein arbeitsrechtliches, sondern ein allgemeines datenschutzrechtliches Problem: In allen Bereichen, in denen Betroffene auf Informationen, Leistungen oder Zugänge angewiesen sind, besteht das Risiko, dass eine Einwilligung nicht frei im Sinne der DSGVO erfolgt.
II. Rechtlicher Rahmen: Art. 6 und Art. 7 DSGVO und die dogmatische Kontur der Freiwilligkeit
1. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO: Die Einwilligung als Ausnahmefall
Die DSGVO betont in ihrer Struktur, dass Einwilligungen nicht der Regelfall sind. Einwilligungen werden als Ausnahmezur Rechtfertigung personenbezogener Verarbeitung verstanden, weil sie stets die Gefahr in sich tragen, unfreiwillig erteilt zu werden.
Die Verarbeitung ist nur dann auf eine Einwilligung gestützt, wenn:
- die Entscheidung informiert,
- eindeutig,
- freiwillig,
- und in spezifischer Weise erfolgt ist.
2. Art. 7 DSGVO: Anforderungen an Freiwilligkeit
Art. 7 DSGVO führt die Freiwilligkeitsanforderungen aus:
- Kein Zwang
- Keine Nachteile bei Verweigerung
- Klare Trennung zwischen Vertragserfüllung und Zusatzverarbeitungen
- Jederzeitige Widerruflichkeit
- Transparenz der Zwecke
Die Rechtsprechung aus dem arbeitsgerichtlichen Bereich (LAG Stuttgart, LAG Sachsen-Anhalt) zeigt, dass Freiwilligkeit entfällt, wenn ein Machtgefälle besteht oder Betroffene nicht real „Nein“ sagen können.
3. Erwägungsgrund 43: Vermutung der Unfreiwilligkeit
Der Erwägungsgrund legt fest:
- Wenn ein Machtungleichgewicht besteht, ist eine Einwilligung vermutlich nicht freiwillig.
- Wenn eine Dienstleistung von einer Einwilligung abhängig gemacht wird, die nicht erforderlich ist, liegt eine unzulässige Kopplung vor.
Diese Prinzipien gelten generell — auch außerhalb des Arbeitsrechts.
4. Interaktion mit Art. 5, 12, 24 und 25 DSGVO
Eine unzulässige Einwilligung führt fast immer zu Verstößen gegen:
- Art. 5 DSGVO (Rechtmäßigkeit, Transparenz)
- Art. 12 DSGVO (Erleichterung der Betroffenenrechte)
- Art. 24 DSGVO (Organisationsverantwortung)
- Art. 25 DSGVO (Privacy by Design)
Die Rechtsprechung — u. a. LG Wuppertal und FG Berlin-Brandenburg — unterstreicht, dass Dokumentations- und Organisationsmängel regelmäßig zu Fehlern bei Einwilligungen führen.
III. Typische Formen unzulässiger Kopplung in der Praxis
1. Verknüpfung von Einwilligung mit Leistungen oder Bearbeitung
Viele Organisationen knüpfen die Erbringung einer Leistung oder das Bearbeiten einer Anfrage faktisch an eine zusätzliche Einwilligung, obwohl diese für den Zweck nicht erforderlich ist. Ein klassisches Beispiel sind Kontakt- oder Supportprozesse, in denen nur weitergeholfen wird, wenn zusätzliche Informationen preisgegeben werden.
2. Einwilligung zur internen Erleichterung statt zur Notwendigkeit
Häufig werden Einwilligungen eingeholt, weil:
- Prozesse unklar sind,
- Systeme schlecht konzipiert sind,
- Verantwortliche Daten lieber zusätzlich sammeln,
- interne Strukturen verworren sind.
Dies verstößt gegen Art. 7 Abs. 4 DSGVO, wonach organisatorische oder technische Bequemlichkeit keine Freiwilligkeit rechtfertigen kann.
3. Einwilligungen in Drucksituationen
Drucksituationen entstehen z. B. wenn:
- Betroffene eine Antwort benötigen,
- Betroffene eine Beschwerde stellen wollen,
- Betroffene Zugang zu bestimmten Bereichen oder Leistungen brauchen.
Die Rechtsprechung zu Einwilligungen unter Abhängigkeitssituationen bestätigt, dass ein solches Umfeld die Freiwilligkeit ausschließt.
4. Unklare und überbreite Einwilligungserklärungen
Viele Einwilligungserklärungen sind:
- zu allgemein,
- missverständlich,
- nicht zweckgebunden,
- mit versteckten Klauseln versehen.
Dies ist mit Art. 5 und Art. 7 DSGVO unvereinbar.
IV. Dogmatische Bewertung: Warum Kopplungen rechtswidrig sind
1. Die Einwilligung darf nicht zur strukturellen Voraussetzung werden
Die DSGVO versteht Einwilligungen als freiwilliges Element — nicht als Bedingung.
Der EuGH betont, dass der Verantwortliche keine strukturelle Abhängigkeit schaffen darf.
2. Organisationsfehler als Ursache unzulässiger Einwilligungen
Die Rechtsprechung des LG Wuppertal erkennt Organisationsfehler als eigenständige Verstöße.
Wer Einwilligungen einholt, weil interne Strukturen nicht funktionieren, verletzt Art. 24 DSGVO.
3. Transparenzprinzip aus Art. 5 DSGVO
Einwilligungen sind nur dann wirksam, wenn der Betroffene versteht:
- weshalb die Daten erhoben werden,
- welche Daten es betrifft,
- wer Empfänger sein wird,
- dass eine Verweigerung folgenlos ist.
Unklare Einwilligungen sind rechtswidrig.
4. Unfreiwilligkeit als unmittelbare Rechtswidrigkeit
Fehlt Freiwilligkeit, ist die Datenverarbeitung insgesamt unrechtmäßig.
Dies führt zu:
- Löschpflichten (Art. 17 DSGVO),
- Schadensersatzansprüchen (Art. 82 DSGVO),
- Bußgeldern (Art. 83 DSGVO).
Gerichte wie LG Leipzig, LG Bonn und OLG Frankfurt erkennen an, dass bereits die Situation mangelnder Kontrolle einen immateriellen Schaden darstellen kann.
V. Folgen für Betroffene
Bei unzulässigen Einwilligungen ergeben sich strukturelle Risiken:
- Betroffene geben Daten preis, die nicht notwendig sind.
- Sie verlieren Überblick über den Zweck der Verarbeitung.
- Sie können ihre Rechte nicht wirksam ausüben, weil der Rechtsgrund fehlerhaft ist.
- Unklare Einwilligungserklärungen werden später gegen sie verwendet.
- Sie müssen mit unklaren oder versteckten Datenflüssen rechnen.
In Auskunftsverfahren zeigt sich häufig, dass Datenkategorien auf Einwilligungen beruhen, die gar nicht hätten eingeholt werden dürfen.
VI. Folgen für Verantwortliche
1. Rechtswidrige Verarbeitung
Eine fehlerhafte Einwilligung macht die gesamte Verarbeitung rechtswidrig, da keine tragfähige Rechtsgrundlage existiert.
2. Pflichtverletzungen nach Art. 5, 6, 7 und 12 DSGVO
Typische Folgefehler:
- unzulässige Erhebung,
- unvollständige Auskünfte,
- fehlende Transparenz,
- unzureichende Dokumentation.
3. Schadensersatz nach Art. 82 DSGVO
Gerichte wie LG Leipzig oder OLG Frankfurt erkennen Schadensersatzansprüche an, wenn Betroffene Daten preisgeben mussten, ohne dass dies freiwillig war.
4. Bußgelder nach Art. 83 DSGVO
Aufsichtsbehörden werten unzulässige Einwilligungen als schwere Verstöße, da sie Grundprinzipien verletzen.
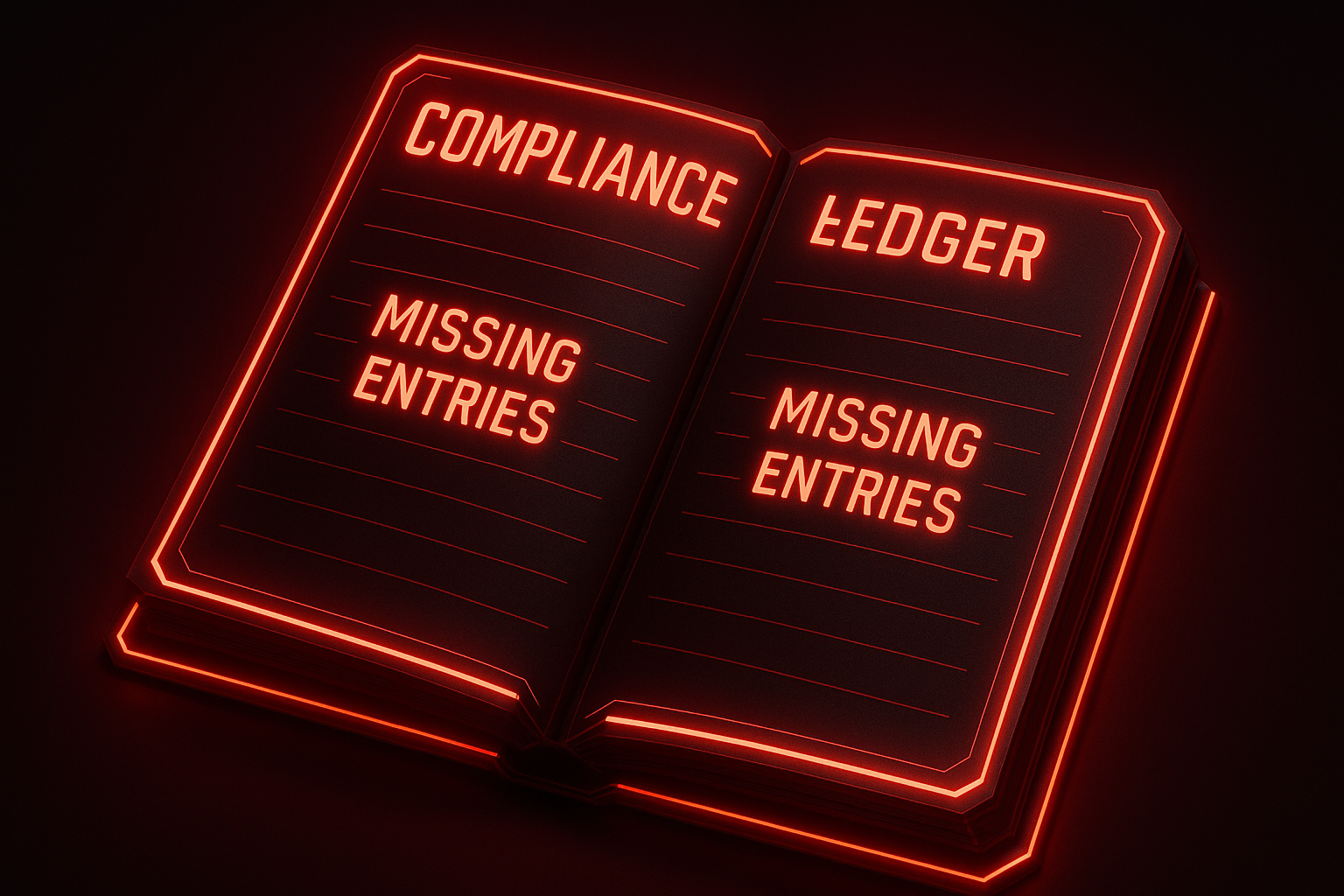
VII. Anforderungen an eine wirksame Einwilligung
Eine wirksame Einwilligung muss:
- freiwillig sein — keine Nachteile, kein Druck.
- informiert sein — klare Formulierungen, verständliche Zwecke.
- zweckgebunden sein — je Zweck eine eigene Einwilligung.
- widerrufbar sein — ohne Nachteile.
- dokumentiert werden können — vollständiger Nachweis.
- separat erfolgen — nicht versteckt in anderen Prozessen.
- nicht Voraussetzung für Leistungen sein, die auch ohne Einwilligung erbracht werden könnten.
Diese Kriterien folgen unmittelbar aus Art. 6, Art. 7 und Art. 5 DSGVO sowie der relevanten Rechtsprechung.
VIII. Handlungsempfehlungen für Betroffene
Betroffene sollten:
- Einwilligungen kritisch prüfen,
- hinterfragen, ob sie tatsächlich erforderlich sind,
- Widerrufsrechte nutzen,
- Auskünfte über die Rechtsgrundlage der Verarbeitung einholen,
- über Aufsichtsbehörden oder anwaltliche Beratung Verstöße klären lassen.
IX. Schlussbetrachtung
Die Einwilligung ist die risikoreichste Rechtsgrundlage der DSGVO. Sie ist nur dann wirksam, wenn sie frei von Druck, Zwang, Kopplung oder struktureller Abhängigkeit erfolgt. Unternehmen müssen ihre Prozesse so gestalten, dass Einwilligungen nur dann eingesetzt werden, wenn keine andere Rechtsgrundlage in Betracht kommt. Die Rechtsprechung macht deutlich, dass Fehler bei der Einwilligung schnell zu rechtswidrigen Verarbeitungen, immateriellen Schäden und erheblichen Haftungsrisiken führen.
CTA
Wenn Sie prüfen möchten, ob eine Einwilligung wirksam war oder ob eine Datenverarbeitung auf einer unzulässigen Kopplung beruht, stehe ich Ihnen für eine fundierte und vertrauliche Beratung zur Verfügung.
Telefon: 0160 9955 5525
Kontakt: https://www.hortmannlaw.com/contact
Wenn Sie weitere Hintergrundanalysen zum Datenschutz suchen, finden Sie hier die wichtigsten vertiefenden Beiträge:
- DSGVO-Auskunft im Spamfilter
https://www.hortmannlaw.com/articles/dsgvo-auskunft-spamfilter - Unvollständige Auskünfte nach Art. 15 DSGVO
https://www.hortmannlaw.com/articles/art15-dsgvo-unvollstaendige-auskunft - Rückfragen als Datenfalle
https://www.hortmannlaw.com/articles/rueckfrage-datenfalle-dsgvo - Social-Media-Überwachung durch Unternehmen
https://www.hortmannlaw.com/articles/social-media-ueberwachung-dsgvo - Organisationsfehler nach Art. 24 DSGVO
https://www.hortmannlaw.com/articles/art24-dsgvo-organisationsfehler - Privacy by Design – warum es in der Praxis scheitert
https://www.hortmannlaw.com/articles/privacy-by-design-scheitert - DSGVO-Probleme in Großunternehmen
https://www.hortmannlaw.com/articles/dsgvo-grossunternehmen-probleme - Zutritts- und Sicherheitsdaten als DSGVO-Risiko
https://www.hortmannlaw.com/articles/zutrittsdaten-dsgvo-sicherheitsbereiche - E-Mail-Systeme als Schwachstelle der DSGVO-Compliance
https://www.hortmannlaw.com/articles/email-systeme-dsgvo-risiko - Schadensersatz bei Kontrollverlust nach Art. 82 DSGVO
https://www.hortmannlaw.com/articles/art82-dsgvo-kontrollverlust - Rechenschaftspflicht nach Art. 5 Abs. 2 DSGVO
https://www.hortmannlaw.com/articles/rechenschaftspflicht-dsgvo - Kameraüberwachung im Garten – Datenschutz unter Nachbarn
https://www.hortmannlaw.com/articles/kamerauberwachung-im-garten---datenschutz-unter-nachbarn - Privatsphäre-Schutz für Hochvermögende
https://www.hortmannlaw.com/articles/privatsphaere-schutz-hochvermoegende - Art. 9 DSGVO & digitale Intimsphäre
https://www.hortmannlaw.com/articles/datenschutz-intimsphaere-art9-dsgvo-digitale-sexarbeit - DeFi, Krypto-Betrug & Datenschutz
https://www.hortmannlaw.com/articles/defi-compliance-datenschutz-krypto-betrug-anwalt - Crypto.com & DSGVO-Pflichten
https://www.hortmannlaw.com/articles/dsgvo-crypto-com-pflichten-krypto-betrug - Datenlecks im Krypto-Betrug
https://www.hortmannlaw.com/articles/datenlecks-krypto-betrug - Verfahrens- & Systemdaten im Netz
https://www.hortmannlaw.com/articles/gesundheits-verfahrensdaten-im-netz - Love Scam & Datenmissbrauch
https://www.hortmannlaw.com/articles/love-scam-datenmissbrauch-opfer-anwalt - Datenschutzpflichten von Krypto-Plattformen
https://www.hortmannlaw.com/articles/die-rolle-von-krypto-plattformen-im-zusammenhang-mit-der-DSGVO - KI, Datenschutz & Strafrecht – Verantwortungsmatrix
https://www.hortmannlaw.com/articles/ki-haftung-datenschutz-und-strafrecht-die-neue-verantwortungsmatrix - Was eine Datenschutzverletzung wirklich kostet
https://www.hortmannlaw.com/articles/was-kostet-eigentlich-eine-datenschutzverletzung
Das könnte Sie auch interessieren
Entdecken Sie weitere Beiträge zu aktuellen Themen rund um Digitalrecht, Cybercrime, Datenschutz, KI und Steuerrecht. Unsere verwandten Artikel geben Ihnen zusätzliche Einblicke und vertiefende Analysen.

.jpg)
Dating App gründen: Was rechtlich zu beachten ist – Haftung, Steuern & Struktur
Eine Dating-App ist keine „Social App“, sondern ein daten- und monetarisierungsgetriebenes Intermediärsystem. Wer Premium, Boosts und Coins anbietet, betreibt nicht nur Produktdesign, sondern schafft rechtlich relevante Leistungsversprechen, Risiken der Plattformverantwortung, bilanzielle Verpflichtungen und Governance‑Pflichten der Geschäftsleitung. Dieser Beitrag zeigt aus Herausgeber‑ und Entwicklerperspektive, wie man eine Dating‑Plattform in Deutschland/EU strukturiert, sodass Haftung, Regulierung und Steuerfolgen beherrschbar bleiben – nicht durch spätere AGB‑Kosmetik, sondern durch Architektur am Anfang.

.jpg)
BitBox, MetaMask, Trust Wallet: Krypto-Betrug ohne Hack und ohne Phishing
Anlagebetrug mit BitBox, MetaMask und Trust Wallet: Kein Hack, keine Phishing-Masche – sondern täuschungsbedingte Eigenüberweisungen. Jetzt einordnen.

.jpg)
Krypto Betrug Geld zurück? Binance, Crypto.com, Coinbase – Chancen, Freeze, rechtliche Schritte
Nach einem Krypto-Betrug ist das Vermögen nicht automatisch verloren. Der Beitrag erklärt, wann Börsen wie Binance, Crypto.com oder Coinbase eingebunden werden können, welche Sicherungsmaßnahmen realistisch sind und welche Versprechen unseriös sind.
Suchen Sie dringend diskrete, juristische Unterstüzung?
Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter – schildern Sie uns Ihr Anliegen und wir finden gemeinsam eine Lösung.