Datenschutz und Intimsphäre – Art. 9 DSGVO als Schutzschild oder Feigenblatt?
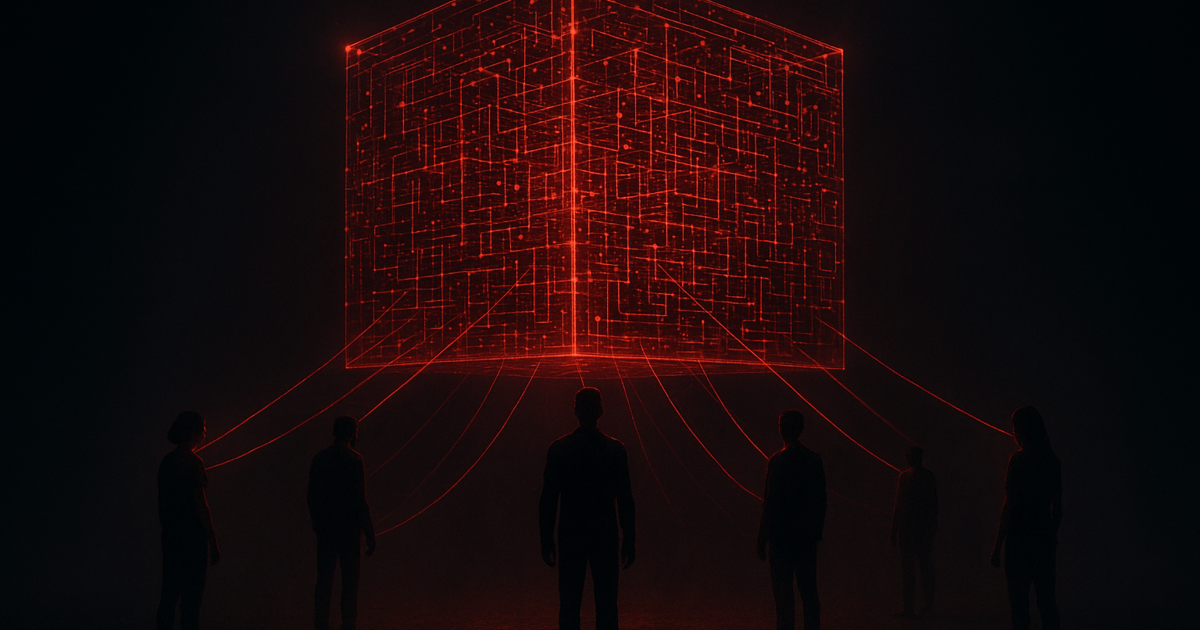

Juristische Expertise
- Cybercrime & Krypto-Betrug
- AI & Zukunftsrecht
- Steuerrecht & Steuerstrafrecht
- Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht & Zivilrecht
- Datenschutz & Digitalrecht
Datenschutz und Intimsphäre – Art. 9 DSGVO als Schutzschild oder Feigenblatt?
1 Einleitung – Privatsphäre im Zeitalter digitaler Intimität
Privatsphäre war einmal eine räumliche Vorstellung. Heute ist sie ein Datensatz.
Im digitalen Zeitalter findet Intimität nicht mehr im Verborgenen statt,
sondern im grellen Licht der Algorithmen. Plattformen, die Nähe vermarkten –
von Sugar-Dating-Apps bis zu Virtual-Girlfriend-Diensten – sammeln biometrische, sexuelle
und finanzielle Informationen, um Vertrauen zu erzeugen, Abhängigkeit zu sichern
und wirtschaftliche Interessen zu realisieren.
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gilt dabei als moralischer Grenzpfosten.
Sie beansprucht, das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung zu garantieren.
Doch in der Praxis wird sie zunehmend zum Feigenblatt:
Sie legitimiert Datenerfassung durch formale Einwilligungen,
während ökonomische Abhängigkeiten jede echte Freiwilligkeit untergraben.
Wie also ist Art. 9 DSGVO im Kontext digitaler Intimität zu bewerten?
Schützt er den Menschen – oder schützt er die Märkte, die aus ihm Daten machen?
Verfasst von Rechtsanwalt Max Nikolas Mischa Hortmann, Vertragsautor bei jurisAZO-ITR und jurisPR-ITR.
2 Rechtsrahmen – Art. 9 DSGVO und §§ 22 KUG, 823 BGB
Art. 9 Abs. 1 DSGVO untersagt die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten.
Dazu zählen Informationen über Gesundheit, sexuelle Orientierung und Biometrie.
Sie sind der Kern der Intimsphäre. Wer solche Daten verarbeitet, muss sich auf
eine der Ausnahmen nach Abs. 2 lit. a – g berufen können – insbesondere auf
die ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Person.
Heckmann/Scheurer (jurisPK-Internetrecht 2024, Kap. 9) betonen,
dass die Ausnahmen restriktiv auszulegen sind.
Gerade Plattformen der digitalen Intimität operieren jedoch genau an dieser Grenze:
Sie verlangen Einwilligung als Eintrittskarte in ihre Geschäftsmodelle.
Die DSGVO erlaubt das – aber sie schützt damit weniger die Autonomie,
als vielmehr die Vertragsfreiheit der Betreiber.
Das nationale Persönlichkeitsrecht (§§ 22 KUG, 823 BGB) ergänzt den Schutz,
doch seine Durchsetzung bleibt schwach.
Im globalen Datenverkehr digitaler Sexarbeit greifen weder territoriale Zuständigkeiten
noch effektive Abwehrrechte. Der Schutz der Intimsphäre wird exportiert,
seine Verletzung importiert.
3 Art. 6 DSGVO und wirtschaftliche Rechtfertigung
Art. 6 Abs. 1 lit. b – f DSGVO bietet den Betreibern einen zweiten Rettungsanker:
Daten dürfen verarbeitet werden, wenn sie „zur Vertragserfüllung erforderlich“
oder „zur Wahrung berechtigter Interessen“ nötig sind.
Diese Formulierung ist zur Generalvollmacht geworden.
Sugar-Dating-Apps und Virtual-Girlfriend-Portale berufen sich auf
„berechtigtes Interesse“ – gemeint ist meist das Interesse an Gewinn.
Tracking, Profiling und KI-basiertes Matchmaking werden so legitimiert.
Schantz (ZD 2023, 347 ff.) weist darauf hin, dass diese Praxis
die normative Logik der DSGVO umkehrt:
Nicht mehr der Mensch steht im Mittelpunkt, sondern die Effizienz der Plattform.
In der Steuerung sozialer Kontakte durch Algorithmen zeigt sich eine doppelte Ironie:
Je präziser Daten Intimität simulieren, desto unfreier wird der Mensch, der sie erzeugt.
4 Datenerhebung und Speicherung – praktische Risiken
Kaum eine Branche sammelt sensiblere Informationen als die digitale Intimitätsökonomie.
Gespeichert werden Chat-Verläufe, Stimmen, Körperdaten,
Geolokationen, Krypto-Wallets und Zahlungsnachweise.
Häufig werden diese Daten unbegrenzt gehalten, ohne Löschkonzept nach Art. 17 DSGVO
oder Prinzip der Datensparsamkeit (Art. 5 Abs. 1 lit. c).
Viele Anbieter binden externe API-Schnittstellen ein – für KI-Analysen, Payment,
Identitätsprüfung. Dabei werden personenbezogene Informationen an Dritte übertragen,
ohne die Anforderungen des Art. 28 DSGVO (Auftragsverarbeitung) zu erfüllen.
Ein Beispiel liefert der Markt der Virtual-Girlfriend-Apps:
Sprachaufnahmen werden dauerhaft gespeichert, um „Persönlichkeit“ zu trainieren.
Damit entsteht ein kontrollfreier Datenpool, der weder vom Nutzer gelöscht
noch von der Aufsicht geprüft werden kann.
Das technische Ziel – Realismus – wird zum juristischen Problem: Entkörperlichung ohne Kontrolle.
5 Einwilligung und Zwang – faktische Freiheit im digitalen Kontext
Art. 4 Nr. 11 und Art. 7 DSGVO fordern, dass Einwilligungen
freiwillig, informiert und widerruflich sind.
Doch Freiwilligkeit ist ein soziales, kein technisches Konzept.
Creator auf OnlyFans oder FanCentro müssen ihre Zustimmung zur Datenverarbeitung geben,
um Einnahmen zu erzielen. Kunden müssen zustimmen, um interagieren zu können.
In beiden Fällen ist die Einwilligung Bedingung der Existenz, nicht Ausdruck der Autonomie.
Salemi/Hajric (DuD 2024, 177 ff.) schlagen vor, aus dem Konzept
sexuellen Konsenses zu lernen: Zustimmung ist nur frei,
wenn sie ohne wirtschaftlichen oder sozialen Druck erfolgt.
Das „Zustimmung durch Nutzung“-Modell vieler Plattformen verletzt Art. 7 Abs. 4 DSGVO.
Wer „Ja“ sagen muss, um überleben zu können, sagt rechtlich gesehen Nein.
6 Verantwortlichkeit und gemeinsame Verarbeitung (Art. 26 DSGVO)
Plattform und Creator entscheiden oft gemeinsam über Zweck und Mittel der Datenverarbeitung – etwa bei Kundenkommunikation, Rechnungsstellung oder Werbung.
Art. 26 DSGVO sieht dafür gemeinsame Verantwortlichkeit vor.
In der Praxis fehlen jedoch klare Vereinbarungen.
Die Haftung nach Art. 82 DSGVO ist gesamtschuldnerisch:
Nutzer können sich an jeden Verantwortlichen wenden.
Heckmann/Scheurer weisen darauf hin, dass diese Norm
zum schärfsten, aber am seltensten genutzten Instrument der DSGVO geworden ist.
Im dezentralen Ökosystem von DeFi- und Blockchain-Projekten,
das du im Rahmen von DeFi-Compliance und Datenschutz analysiert hast,
wird Verantwortung fragmentiert: Viele Akteure, kein Ansprechpartner.
Das Risiko ist strukturell, nicht individuell.
7 Datenübermittlung und Meldepflichten – Schnittstelle zu Projekt 370
Die steuerliche Kontrolle digitaler Märkte basiert auf Daten.
DAC 7 und das Plattformen-Steuertransparenzgesetz (PStTG) verpflichten
Betreiber zur Weitergabe von Nutzer- und Transaktionsinformationen an Finanzbehörden.
Hier kollidieren zwei Prinzipien:
- Art. 9 DSGVO → Verbot der Verarbeitung sexueller Daten.
- § 30 AO → Pflicht zur Offenlegung steuerrelevanter Informationen.
Projekt 370 hat gezeigt, dass Steuertransparenz politisch Vorrang genießt.
Die Finanzverwaltung nutzt Datenströme, die ursprünglich dem Datenschutz unterlagen,
zur Risikoanalyse und Verdachtsmeldung.
Damit wird Datenschutz funktionalisiert – vom Grundrecht zum Ermittlungswerkzeug.
Die Kernfrage lautet: Wem gehört das Recht auf Intimsphäre,
wenn Staat und Plattform denselben Datensatz beanspruchen?
8 Aufsicht und Durchsetzung
Die Zuständigkeiten sind verteilt:
LfDI Baden-Württemberg, BayLDA und BfDI auf nationaler Ebene;
der European Data Protection Board (EDPB) auf EU-Ebene.
Doch Ressourcen fehlen, vor allem bei KI-gestützten Plattformen.
Bußgelder nach Art. 83 DSGVO können bis zu 4 % des Jahresumsatzes betragen,
werden aber selten verhängt.
Das Verfahren gegen AI Companion Europe GmbH (2025) – wegen unerlaubter Speicherung
von Sprachdaten – endete mit einer symbolischen Sanktion.
Es zeigt, dass Aufsicht ohne Technikkompetenz ins Leere läuft.
9 Gesellschaftliche und rechtspolitische Bewertung
Die DSGVO war als Bollwerk gedacht, doch sie ist ein Spiegel geworden.
Sie reflektiert gesellschaftliche Machtverhältnisse, ohne sie zu verändern.
Einwilligung ersetzt Kontrolle, Transparenz ersetzt Verantwortung.
Die Gefahr der „Selbstverdatung“ wächst:
Nutzer und Creator liefern freiwillig die sensibelsten Daten ihres Lebens,
weil Plattformen Zuwendung versprechen oder Einkommen sichern.
So entsteht ein neues Verhältnis zwischen Freiheit und Kontrolle:
Der Schutz der Intimsphäre wird zur Pflicht zur Offenlegung.
Wie schon bei der analogen Sexarbeit – vgl. Fehlende Regulierung der Sexarbeit –
führt staatliche Abwesenheit zu privater Übermacht.
Die Rechtspolitik muss die Intimsphäre als soziales Grundrecht begreifen,
nicht als Klickkästchen.
10 Fazit
Art. 9 DSGVO ist das juristische Herzstück des Datenschutzes,
aber er schlägt im Rhythmus des Marktes.
Solange wirtschaftliche Abhängigkeit Freiwilligkeit ersetzt,
bleibt der Schutz der Intimsphäre Illusion.
Datenschutz darf nicht nur verhindern,
er muss gestalten: technische, soziale und ökonomische Strukturen,
in denen Einwilligung wieder Entscheidung bedeutet.
Recht ist nicht die Bremse der Digitalisierung, sondern ihre ethische Architektur.
11 Call-to-Action
Sie verarbeiten sensible Daten auf digitalen Plattformen oder beraten Betreiber digitaler Intimitätsdienste?
Kontaktieren Sie Rechtsanwalt Max Nikolas Mischa Hortmann, Frankfurt am Main,
Vertragsautor bei jurisAZO-ITR und jurisPR-ITR, 📞 0160 9955 5525 oder über hortmannlaw.com/contact.
12 Fundstellen
- Heckmann/Scheurer, jurisPK-Internetrecht 8. Aufl. 2024, Kap. 9.
- Schantz, Einwilligung im digitalen Zeitalter, ZD 2023, 347 ff.
- B. Recht, Direktwerbung und Datenschutz, Steuerberater-Branchenhandbuch 2025.
- Salemi/Hajric, Datenschützer und sexueller Konsens, DuD 2024, 177 ff.
- Rost, „Consent or Pay“-Modelle, K&R 2024, 698 ff.
- Seer, PStTG und DAC 7, IWB 2025, 479 ff.
- Projekt 370 – Hortmann 2025.
🩸 Beiträge im Überblick
1️⃣ Digitale Prostitution und Plattformhaftung – rechtliche Grauzonen im Netz
Wie Plattformen rechtliche Verantwortlichkeiten verschieben und wann Moderation zur Beihilfe wird.
2️⃣ AI-Avatare und virtuelle Sexarbeit – zwischen Kunstfreiheit und Pornografiegesetz
Künstliche Identitäten, Deepfakes und die Frage, ob virtuelle Erotik Kunst oder Sexarbeit ist.
3️⃣ OnlyFans, FanCentro & Co. – steuerliche Behandlung digitaler Sexarbeit
Wie Einnahmen aus digitaler Intimität steuerlich einzuordnen sind – von Einkommensteuer bis Umsatzsteuer.
4️⃣ Datenschutz und Intimsphäre – Art. 9 DSGVO als Schutzschild oder Feigenblatt?
Wenn intime Daten zum Geschäftsmodell werden – Grenzen des Datenschutzes in der Sexarbeit.
5️⃣ Digitale Prostitution vs. Love Scamming – Täuschung, Einwilligung und Ausnutzung
Wie emotionale Manipulation ökonomische Abhängigkeit schafft – und wann Strafbarkeit beginnt.
6️⃣ Plattformökonomie und Arbeitsrecht – Scheinselbstständigkeit im Erotiksektor
Selbstständigkeit oder abhängige Beschäftigung? Arbeitsrechtliche Grenzen digitaler Sexarbeit.
7️⃣ Strafrechtliche Verantwortung – von der Förderung zur digitalen Zuhälterei
§ 181a StGB im Zeitalter der Plattformökonomie: Wer trägt strafrechtliche Verantwortung?
8️⃣ Digitale Prostitution im internationalen Kontext – Regulierung in EU, USA, Asien
Rechtsvergleich zwischen Liberalisierung, Plattformverbot und digitaler Überwachung.
9️⃣ Digitale Sexarbeit und Steuerfahndung – Geldwäsche und Krypto-Zahlungen
Wie Finanzbehörden digitale Einnahmen nachvollziehen – und wann der Verdacht auf Geldwäsche entsteht.
🔟 Digitale Prostitution als Schattenmarkt – Kontrollverlust des Staates
Warum bestehende Gesetze an der digitalen Realität scheitern – und welche Reformen nötig sind.
🔹 Cluster II – Sugar-Dating & Sugar-Babe-Prostitution
Juristische Analysen zur rechtlichen Einordnung von Sugar-Arrangements, Datenschutz, Steuerrecht und Strafbarkeit.
Diese Serie untersucht die Grauzone zwischen Beziehung und entgeltlicher Leistung – von emotionaler Abhängigkeit bis Plattformhaftung.
💎 Beiträge im Überblick
1️⃣ Sugar-Daddy-Plattformen und rechtliche Bewertung – Zwischen Beziehung und Bezahlung
Wie digitale Plattformen Beziehungen monetarisieren – und wo das Zivilrecht Grenzen zieht.
2️⃣ Vertrag oder Täuschung? – Zivilrechtliche Einordnung von Sugar-Arrangements
Zwischen Einvernehmen und Irreführung – wann eine Beziehung zur vertraglichen Leistung wird.
3️⃣ Steuerrechtliche Bewertung – Liebesbeziehung oder gewerbliche Tätigkeit?
Wie Finanzämter Sugar-Arrangements einordnen – und welche steuerstrafrechtlichen Risiken bestehen.
4️⃣ Datenschutz und Intimsphäre – Art. 9 DSGVO bei Sugar-Daddy-Daten
Intime Informationen als Risikofaktor – Datenschutzrechtliche Grenzen der Vermittlungsportale.
5️⃣ Täuschung, Abhängigkeit und Nötigung – Strafbarkeit digitaler Sugar-Beziehungen
Wann emotionale und ökonomische Abhängigkeit zur Strafbarkeit führt.
6️⃣ Plattformhaftung und Vermittlungsverantwortung – digitale Zuhälterei 2.0
Grenzen der Betreiberhaftung nach § 181a StGB im digitalen Raum.
7️⃣ Finanzielle Abhängigkeit und emotionale Erpressung – Sugar-Babe als Opferstruktur
Wie Abhängigkeit systematisch entsteht – und welche Rechtsfolgen sie auslöst.
8️⃣ Arbeitsrechtliche Einordnung – Beschäftigung, Selbstständigkeit oder Schutzlücke?
Wann Sugar-Beziehungen arbeitsrechtlich relevant werden – eine Analyse nach § 611a BGB.
9️⃣ Internationale Dimension – Regulierung digitaler Sugar-Dating-Portale
Wie EU und USA unterschiedlich reagieren – und wo Deutschland steht.
🔟 Gesellschaftliche und rechtspolitische Bewertung – Sugar-Dating als Normalisierung digitaler Abhängigkeit
Warum Sugar-Dating mehr ist als ein Beziehungsphänomen – und was es über digitale Machtverhältnisse verrät.
⚖️ Empfohlene weiterführende Beiträge
Diese ergänzenden Artikel vertiefen zentrale Themen aus beiden Clustern – von Datenschutz und Steuerrecht bis hin zur Strafverfolgung digitaler Beziehungen.
Digitalisierung & Datenschutz in der WEG– Pflichten, Risiken, Chancen
https://www.hortmannlaw.com/articles/weg-digitalisierung-datenschutz
DSGVO Anfrage Risiko
https://www.hortmannlaw.com/articles/dsgvo-anfrage-risiko
Industriespionage und Datenschutz
https://www.hortmannlaw.com/articles/industriespionage-und-datenschutz
CEO-Fraud und Business-E-Mail-Compromise –Unternehmensbetrug durch Täuschung
https://www.hortmannlaw.com/articles/ceo-fraud-business-email
Industriespionage und Datenschutz
https://www.hortmannlaw.com/articles/industriespionage-und-datenschutz
Das könnte Sie auch interessieren
Entdecken Sie weitere Beiträge zu aktuellen Themen rund um Digitalrecht, Cybercrime, Datenschutz, KI und Steuerrecht. Unsere verwandten Artikel geben Ihnen zusätzliche Einblicke und vertiefende Analysen.

.jpg)
Gesellschaftliche und rechtspolitische Bewertung – Sugar-Dating als Normalisierung digitaler Abhängigkeit
Sugar-Dating spiegelt gesellschaftliche Werte im digitalen Zeitalter. Der Abschlussbeitrag ordnet das Phänomen juristisch und rechtspolitisch ein.
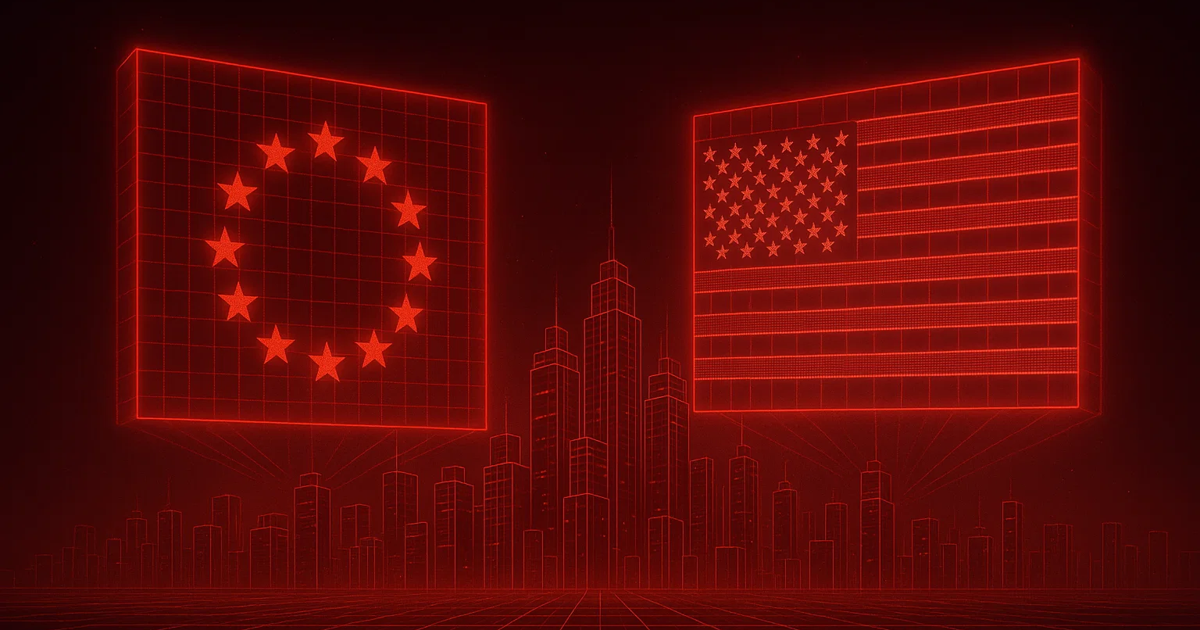
.jpg)
Internationale Dimension – Regulierung digitaler Sugar-Dating-Portale
Digitale Sugar-Dating-Portale stehen weltweit unter Druck. Der Beitrag zeigt, wie EU und USA rechtlich unterschiedlich reagieren und wo Deutschland steht.

.jpg)
Arbeitsrechtliche Einordnung – Beschäftigung, Selbstständigkeit oder Schutzlücke?
Der Beitrag beleuchtet, ob Sugar-Babe-Beziehungen arbeitsrechtlich Schutz erfordern – oder eine rechtliche Leerstelle bilden.
Suchen Sie dringend diskrete, juristische Unterstüzung?
Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter – schildern Sie uns Ihr Anliegen und wir finden gemeinsam eine Lösung.