Privacy by Design gescheitert: Die echten Gründe für DSGVO-Systemversagen
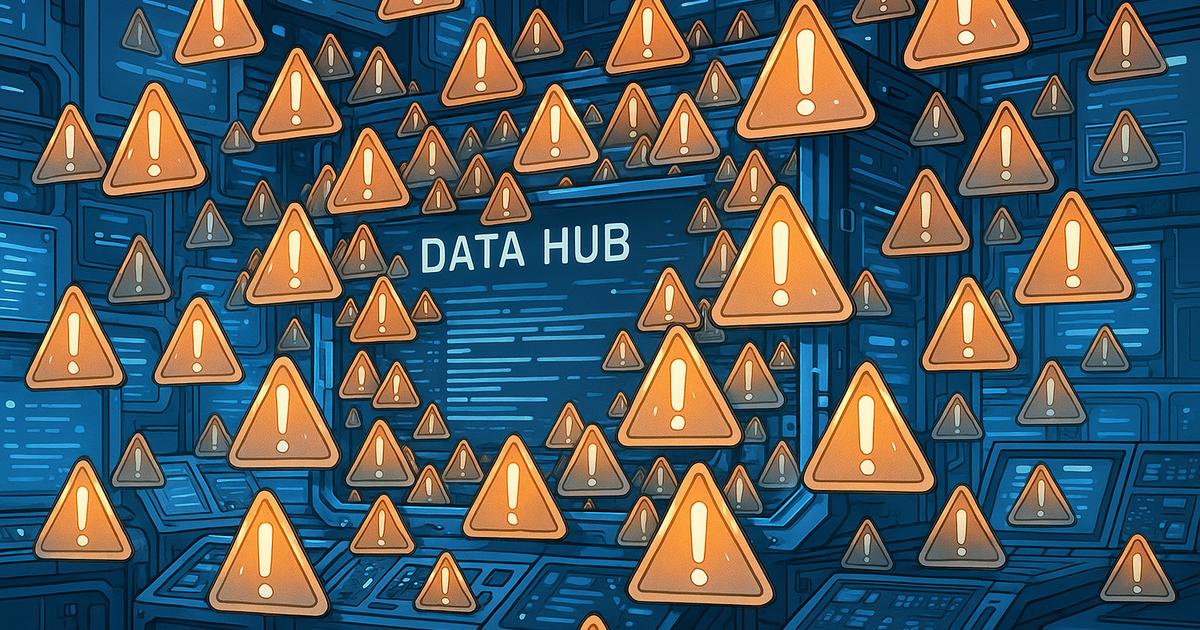

Juristische Expertise
- Cybercrime & Krypto-Betrug
- AI & Zukunftsrecht
- Steuerrecht & Steuerstrafrecht
- Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht & Zivilrecht
- Datenschutz & Digitalrecht
Privacy by Design scheitert: Strukturelle Fehlumsetzungen nach Art. 25 DSGVO und ihre rechtlichen Folgen
I. Einleitung: Privacy by Design als Kernanforderung der modernen Datenverarbeitung
Art. 25 DSGVO verankert das Prinzip „Privacy by Design“ als zentrales Steuerungsinstrument im Datenschutzrecht. Die Vorschrift verpflichtet Verantwortliche, Datenschutz in die Systemarchitektur einzubauen und nicht erst nachträglich zu ergänzen. Ziel ist die technische und organisatorische Vorabgestaltung, die sicherstellt, dass datenschutzrechtliche Pflichten nicht nur erfüllt, sondern systematisch ermöglicht werden.
Die rechtliche Bedeutung dieser Vorschrift wurde durch die Rechtsprechung der Unionsgerichte erheblich gestärkt. Der EuGH hat in C-340/21 darauf hingewiesen, dass Datenschutz nicht reaktiv, sondern präventiv zu gestalten ist. Nationale Gerichte — darunter das OVG Hamburg, das LG Wuppertal und mehrere Finanzgerichte wie das FG Berlin-Brandenburg — betonen, dass technische Fehlkonfigurationen und organisatorische Lücken regelmäßig auf mangelnde Umsetzung von Privacy by Design zurückzuführen sind.
In der Praxis wird Privacy by Design dennoch häufig verfehlt. Unternehmen konzentrieren sich auf punktuelle Anpassungen, statt Datenschutz als strukturgebenden Bestandteil technischer und organisatorischer Prozesse zu verstehen. Der Grund liegt häufig in fehlender Integration des Datenschutzes in die Systemarchitektur, unvollständiger Risikoanalyse oder fehlenden Kontrollmechanismen.
II. Rechtlicher Rahmen: Art. 25 DSGVO und seine dogmatische Einordnung
1. Ziel und Zweck des Art. 25 DSGVO
Art. 25 DSGVO verpflichtet Verantwortliche, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, die eine DSGVO-konforme Verarbeitung ermöglichen. Dies betrifft:
- die technische Systemarchitektur,
- die Standardkonfigurationen („Privacy by Default“),
- die Protokollierung,
- die Zugriffskontrolle,
- die transparente Darstellung des Datenflusses,
- die Risikoanpassung.
Die Norm ist eng mit Art. 24 DSGVO (Organisationsverantwortung) und Art. 32 DSGVO (Sicherheit der Verarbeitung) verbunden.
2. Zusammenhang mit Rechenschaftspflicht und Transparenz
Art. 25 DSGVO verlangt Nachweisbarkeit.
Der EuGH (C-340/21) betont:
Verantwortliche müssen zeigen können, dass die Datenschutzprinzipien in die technische Ausgestaltung eingeflossen sind.
Das FG Berlin-Brandenburg stellt klar, dass fehlende Dokumentation der Systemarchitektur als Verstoß gegen die Rechenschaftspflicht einzustufen ist.
3. Verarbeitungsrisiko als Maßstab
Die Maßnahmen müssen dem Risiko entsprechen. Größere, komplexere oder automatisierte Systeme erfordern höhere Anforderungen an Systemdesign, Dokumentation und Kontrolle. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz wirkt hier risikobasiert.
III. Typische Fehlumsetzungen von Privacy by Design
1. Fehlende Integration in der technischen Architektur
In vielen Unternehmen wird Datenschutz nicht in der Systementwicklung berücksichtigt. Systeme werden produktiv gesetzt, bevor Datenschutzanforderungen eingearbeitet sind.
Dies führt dazu, dass:
- Datenflüsse nicht nachvollziehbar sind,
- Protokollierungen fehlen,
- Risiken nicht bewertet wurden,
- Updates ohne Datenschutzprüfung erfolgen.
2. Unzureichende Standardkonfigurationen („Privacy by Default“)
Systeme sind häufig so gestaltet, dass:
- mehr Daten erhoben werden als notwendig,
- Dateien oder Logs länger gespeichert werden als erforderlich,
- unnötige Schnittstellen aktiv sind,
- Nutzerkonten mit weitreichenden Rechten voreingestellt sind.
Diese Abweichungen widersprechen Art. 25 Abs. 2 DSGVO.
3. Mangelnde Protokollierung
Art. 32 DSGVO und die Rechtsprechung fordern Protokollierung.
Ohne Logs können Verantwortliche weder internen Zugriff nachweisen noch Datenflüsse rekonstruieren. Fehlen Logs, wird Privacy by Design regelmäßig verfehlt.
4. Unklare Systemverantwortlichkeiten
Datenschutz wird nicht als integraler Bestandteil der IT verstanden.
Dadurch entstehen folgende Defizite:
- fehlende Abstimmung zwischen IT, Compliance, Legal und Fachbereichen,
- unklare Zugriffsrechte,
- unzureichende Prüfmechanismen bei Systemanpassungen.
5. Fehlende Risikoanalysen
Art. 25 DSGVO verlangt eine kontinuierliche Neubewertung der Verarbeitung.
In der Praxis fehlen:
- aktuelle Risikoanalysen,
- Prüfungen bei neuen Verarbeitungen,
- Anknüpfungspunkte an Datenschutz-Folgenabschätzungen.
6. Technische Fehlkonfigurationen
Das LG Wuppertal und mehrere finanzgerichtliche Entscheidungen betonen, dass technische Fehlkonfigurationen regelmäßig Ausdruck eines Verstoßes gegen Art. 25 DSGVO sind. Beispiele sind:
- falsch gesetzte Filter,
- fehlende Redundanzen,
- unzureichende Mail-Routing-Systeme,
- fehlende Monitoring-Funktionen.

IV. Dogmatische Bewertung: Warum das Scheitern von Privacy by Design rechtswidrig ist
1. Privacy by Design ist kein optionaler Standard
Die Vorschrift ist zwingendes Recht.
Der EuGH betont, dass Datenschutz in die Systeme „eingebaut“ sein muss — nicht durch organisatorische Maßnahmen kompensiert.
2. Fehlende Umsetzung führt zu strukturellen Datenschutzverstößen
Unternehmen, die Privacy by Design nicht umsetzen, verletzen gleichzeitig:
- Art. 5 DSGVO (Grundprinzipien),
- Art. 12 DSGVO (Transparenz),
- Art. 30 DSGVO (Dokumentation),
- Art. 32 DSGVO (Sicherheit).
3. Fehlende Nachweisbarkeit ist ein eigener Verstoß
Die Rechenschaftspflicht verlangt, dass Verantwortliche die Umsetzung dokumentieren.
Das FG Berlin-Brandenburg bestätigt, dass fehlende Dokumentation allein bereits eine Verletzung der DSGVO darstellt.
4. Fehlende technische Schutzmechanismen führen zu Kontrollverlust
Wird Privacy by Design nicht umgesetzt, kann der Verantwortliche keine konsistenten Aussagen über Datenflüsse, Zugriffe oder Risiken treffen. Dies führt dazu, dass Betroffenenrechte (z. B. Art. 15 oder 17 DSGVO) nicht ordnungsgemäß erfüllt werden können.
V. Folgen für Betroffene
Defizite in Privacy by Design wirken sich auf verschiedene Ebenen aus:
- Betroffenenrechte können verzögert oder unvollständig erfüllt werden.
- Datenflüsse bleiben intransparent.
- Auskünfte nach Art. 15 DSGVO sind häufig unvollständig.
- Löschpflichten werden nicht ordnungsgemäß umgesetzt.
- Risiken bleiben unerkannt, weil interne Kontrollmechanismen fehlen.
Die Rechtsprechung (z. B. LG Leipzig, LG Bonn, LG Osnabrück, OLG Frankfurt) erkennt an, dass dieser Zustand zu einem immateriellen Schaden im Sinne von Art. 82 DSGVO führen kann, da Betroffene keine Kontrolle über die Verarbeitung ihrer Daten haben.
VI. Folgen für Verantwortliche: Bußgelder, Haftung und strukturelle Mängel
1. Bußgelder nach Art. 83 DSGVO
Verstöße gegen Art. 25 DSGVO werden von Aufsichtsbehörden streng geahndet.
Privacy by Design wird als grundlegender Bestandteil jeder Verarbeitung angesehen.
2. Schadensersatz nach Art. 82 DSGVO
Gerichte erkennen Schadensersatzansprüche an, wenn der Verantwortliche keine funktionierenden technischen Maßnahmen vorweisen kann.
Wichtig ist die ständige Rechtsprechung, die bestätigt, dass Kontrollverlust und mangelnde Transparenz bereits als immaterieller Schaden gelten.
3. Organisationsverschulden (Art. 24 DSGVO)
Ein Verstoß gegen Art. 25 DSGVO ist zugleich ein Verstoß gegen Art. 24 DSGVO.
Das LG Wuppertal stuft mangelnde Strukturen regelmäßig als eigenständigen Datenschutzverstoß ein.
4. Folgefehler
Ein Scheitern von Privacy by Design hat unmittelbare Auswirkungen auf zahlreiche Pflichten:
- Art. 15: Auskunft unvollständig
- Art. 17: Löschung nicht möglich
- Art. 30: Verzeichnis lückenhaft
- Art. 32: unzureichende Sicherheitsmaßnahmen
VII. Anforderungen an ein wirksames Privacy-by-Design-Konzept
Ein wirksames Konzept muss folgende Elemente beinhalten:
- Technische Architekturplanung
Integration von Datenschutzanforderungen bereits bei der Entwicklung. - Privacy by Default
Strenge Einschränkung voreingestellter Optionen. - Protokollierung und Monitoring
Nachvollziehbarkeit aller Zugriffe und Verarbeitungen. - Datenminimierung auf technischer Ebene
Begrenzung von Feldern, Logs und Speicherfristen. - Systematische Risikoanalysen
regelmäßige Aktualisierung bei neuen Verarbeitungen. - Interne Richtlinien und Entwicklungsstandards
klare Anforderungen an IT, Produktteams und Compliance. - Technische Tests und Audits
regelmäßige Überprüfung der Schutzmechanismen.
Diese Elemente entsprechen den Anforderungen aus Art. 24, Art. 25 und Art. 32 DSGVO sowie der Rechtsprechung der nationalen und europäischen Gerichte.
VIII. Handlungsempfehlungen für Betroffene
Wenn Zweifel an der technischen Umsetzung oder an der Systemarchitektur entstehen, sollten Betroffene:
- eine detaillierte Auskunft nach Art. 15 DSGVO einholen,
- die Herkunft und Kategorien der verarbeiteten Daten prüfen,
- die technischen Schutzmaßnahmen hinterfragen,
- eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde erwägen,
- bei Verdacht eines systemischen Fehlers rechtliche Unterstützung suchen.
Privacy by Design wirkt im Hintergrund der Verarbeitung, aber seine Defizite zeigen sich in der Praxis schnell durch unklare Prozesse, fehlende Transparenz oder unvollständige Auskünfte.

IX. Schlussbetrachtung
Art. 25 DSGVO verpflichtet Verantwortliche, Datenschutz nicht als nachgelagertes Compliance-Element zu verstehen, sondern als strukturelle Gestaltungsaufgabe. Viele Unternehmen scheitern an dieser Aufgabe, weil sie Datenschutz nicht in ihre technische Architektur integrieren oder die Risiken ihrer Verarbeitung unterschätzen. Die Rechtsprechung macht deutlich, dass fehlende Umsetzung regelmäßig zu rechtswidrigen Verarbeitungen führt — unabhängig davon, ob ein konkreter Schaden sichtbar wird.
Privacy by Design ist damit nicht nur ein technischer Standard, sondern eine rechtliche Pflicht. Wer sie verfehlt, riskiert erhebliche Sanktionen und strukturelle Folgeschäden.
CTA
Wenn Sie prüfen möchten, ob ein Unternehmen die Anforderungen des Art. 25 DSGVO erfüllt oder ob technische und organisatorische Strukturen unzureichend sind, stehe ich Ihnen für eine vertrauliche und sorgfältige Beratung zur Verfügung.
Telefon: 0160 9955 5525
Kontakt: https://www.hortmannlaw.com/contact
Wenn Sie weitere Hintergrundanalysen zum Datenschutz suchen, finden Sie hier die wichtigsten vertiefenden Beiträge:
- DSGVO-Auskunft im Spamfilter
https://www.hortmannlaw.com/articles/dsgvo-auskunft-spamfilter - Unvollständige Auskünfte nach Art. 15 DSGVO
https://www.hortmannlaw.com/articles/art15-dsgvo-unvollstaendige-auskunft - Rückfragen als Datenfalle
https://www.hortmannlaw.com/articles/rueckfrage-datenfalle-dsgvo - Social-Media-Überwachung durch Unternehmen
https://www.hortmannlaw.com/articles/social-media-ueberwachung-dsgvo - Organisationsfehler nach Art. 24 DSGVO
https://www.hortmannlaw.com/articles/art24-dsgvo-organisationsfehler - DSGVO-Probleme in Großunternehmen
https://www.hortmannlaw.com/articles/dsgvo-grossunternehmen-probleme - Zutritts- und Sicherheitsdaten als DSGVO-Risiko
https://www.hortmannlaw.com/articles/zutrittsdaten-dsgvo-sicherheitsbereiche - E-Mail-Systeme als Schwachstelle der DSGVO-Compliance
https://www.hortmannlaw.com/articles/email-systeme-dsgvo-risiko - Einwilligung unter Druck – unzulässige Kopplungen
https://www.hortmannlaw.com/articles/dsgvo-einwilligung-druck - Schadensersatz bei Kontrollverlust nach Art. 82 DSGVO
https://www.hortmannlaw.com/articles/art82-dsgvo-kontrollverlust - Rechenschaftspflicht nach Art. 5 Abs. 2 DSGVO
https://www.hortmannlaw.com/articles/rechenschaftspflicht-dsgvo - Kameraüberwachung im Garten – Datenschutz unter Nachbarn
https://www.hortmannlaw.com/articles/kamerauberwachung-im-garten---datenschutz-unter-nachbarn - Privatsphäre-Schutz für Hochvermögende
https://www.hortmannlaw.com/articles/privatsphaere-schutz-hochvermoegende - Art. 9 DSGVO & digitale Intimsphäre
https://www.hortmannlaw.com/articles/datenschutz-intimsphaere-art9-dsgvo-digitale-sexarbeit - DeFi, Krypto-Betrug & Datenschutz
https://www.hortmannlaw.com/articles/defi-compliance-datenschutz-krypto-betrug-anwalt - Crypto.com & DSGVO-Pflichten
https://www.hortmannlaw.com/articles/dsgvo-crypto-com-pflichten-krypto-betrug - Datenlecks im Krypto-Betrug
https://www.hortmannlaw.com/articles/datenlecks-krypto-betrug - Verfahrens- & Systemdaten im Netz
https://www.hortmannlaw.com/articles/gesundheits-verfahrensdaten-im-netz - Love Scam & Datenmissbrauch
https://www.hortmannlaw.com/articles/love-scam-datenmissbrauch-opfer-anwalt - Datenschutzpflichten von Krypto-Plattformen
https://www.hortmannlaw.com/articles/die-rolle-von-krypto-plattformen-im-zusammenhang-mit-der-DSGVO - KI, Datenschutz & Strafrecht – Verantwortungsmatrix
https://www.hortmannlaw.com/articles/ki-haftung-datenschutz-und-strafrecht-die-neue-verantwortungsmatrix - Was eine Datenschutzverletzung wirklich kostet
https://www.hortmannlaw.com/articles/was-kostet-eigentlich-eine-datenschutzverletzung
Das könnte Sie auch interessieren
Entdecken Sie weitere Beiträge zu aktuellen Themen rund um Digitalrecht, Cybercrime, Datenschutz, KI und Steuerrecht. Unsere verwandten Artikel geben Ihnen zusätzliche Einblicke und vertiefende Analysen.

.jpg)
Dating App gründen: Was rechtlich zu beachten ist – Haftung, Steuern & Struktur
Eine Dating-App ist keine „Social App“, sondern ein daten- und monetarisierungsgetriebenes Intermediärsystem. Wer Premium, Boosts und Coins anbietet, betreibt nicht nur Produktdesign, sondern schafft rechtlich relevante Leistungsversprechen, Risiken der Plattformverantwortung, bilanzielle Verpflichtungen und Governance‑Pflichten der Geschäftsleitung. Dieser Beitrag zeigt aus Herausgeber‑ und Entwicklerperspektive, wie man eine Dating‑Plattform in Deutschland/EU strukturiert, sodass Haftung, Regulierung und Steuerfolgen beherrschbar bleiben – nicht durch spätere AGB‑Kosmetik, sondern durch Architektur am Anfang.

.jpg)
BitBox, MetaMask, Trust Wallet: Krypto-Betrug ohne Hack und ohne Phishing
Anlagebetrug mit BitBox, MetaMask und Trust Wallet: Kein Hack, keine Phishing-Masche – sondern täuschungsbedingte Eigenüberweisungen. Jetzt einordnen.

.jpg)
Krypto Betrug Geld zurück? Binance, Crypto.com, Coinbase – Chancen, Freeze, rechtliche Schritte
Nach einem Krypto-Betrug ist das Vermögen nicht automatisch verloren. Der Beitrag erklärt, wann Börsen wie Binance, Crypto.com oder Coinbase eingebunden werden können, welche Sicherungsmaßnahmen realistisch sind und welche Versprechen unseriös sind.
Suchen Sie dringend diskrete, juristische Unterstüzung?
Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter – schildern Sie uns Ihr Anliegen und wir finden gemeinsam eine Lösung.