Smart-Contract-Haftung im Krypto-Betrug – Anwalt über Fehler im Code und Verantwortlichkeit
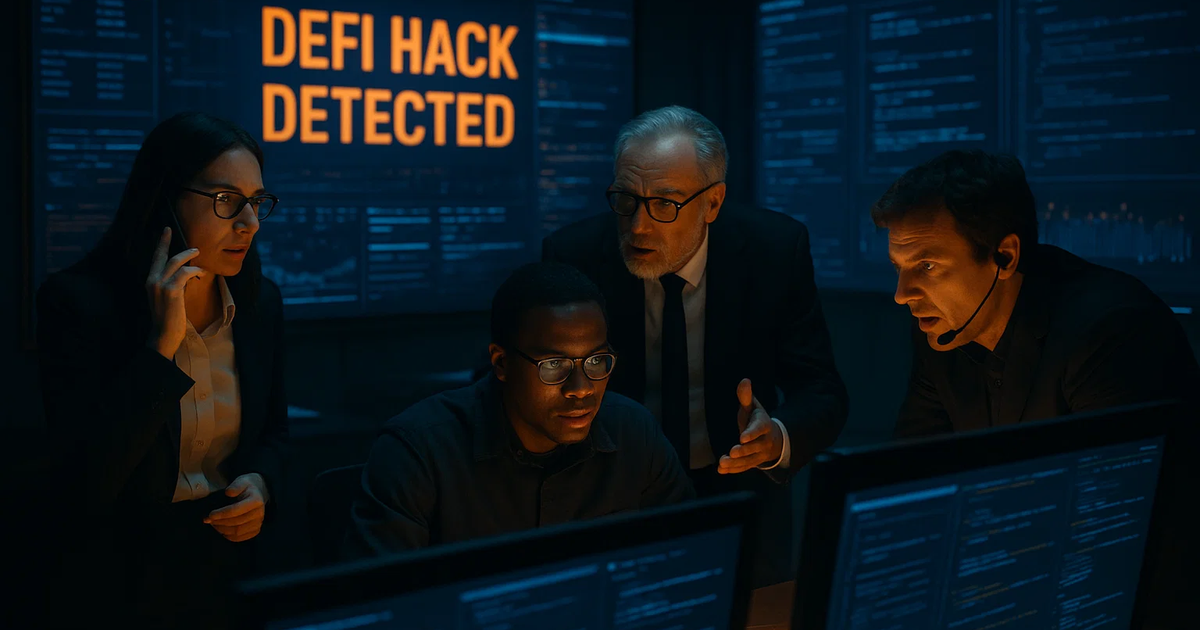

Juristische Expertise
- Cybercrime & Krypto-Betrug
- AI & Zukunftsrecht
- Steuerrecht & Steuerstrafrecht
- Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht & Zivilrecht
- Datenschutz & Digitalrecht
Smart-Contract-Haftung – Verantwortung bei Fehlern im Code
Meta-Description
Smart-Contract-Haftung: Anwalt erklärt, wann Entwickler, Betreiber oder Plattformen für Fehler im Code, Sicherheitslücken und DeFi-Schäden haften.
I. Einleitung – Wenn Vertrauen programmiert wird
Smart Contracts sind das Fundament der Dezentralisierung.
Sie führen Transaktionen aus, kontrollieren Liquiditätspools, verwalten digitale Vermögenswerte – ganz ohne Bank, Notar oder Broker.
Doch was geschieht, wenn der Code selbst fehlerhaft ist?
Wer trägt die Verantwortung, wenn ein Algorithmus falsch rechnet, wenn ein Sicherheits-Bug zu Millionenverlusten führt oder ein Update das gesamte System lahmlegt?
Während Smart Contracts technische Effizienz schaffen, verschieben sie auch die jurische Verantwortung.
An die Stelle menschlicher Entscheidungen treten Zeilen aus Solidity-Code.
Wenn diese Zeilen Fehler enthalten, entstehen neue Haftungsebenen – und damit ein Betätigungsfeld, in dem anwaltliche Expertise und technische Kompetenz untrennbar sind.
II. Rechtliche Einordnung des Smart Contracts
Der Begriff „Smart Contract“ ist irreführend: Er ist kein Vertrag im zivilrechtlichen Sinn, sondern ein technischer Mechanismus, der vertragliche Pflichten automatisiert erfüllt.
Juristisch betrachtet ist der Code eine Leistungshandlung – ähnlich wie ein Automat, der bei Münzeinwurf Ware ausgibt.
Daraus folgt:
- Die Rechtswirkung entsteht aus dem ursprünglichen Vertrag zwischen den Parteien, nicht aus dem Code selbst.
- Fehlerhafte Programmierung kann aber zu Schadensersatz- oder Produkthaftungsansprüchen führen.
Ein Smart Contract ist damit kein Rechtssubjekt, sondern ein Werkzeug.
Doch wer dieses Werkzeug konstruiert oder in den Umlauf bringt, übernimmt Verantwortung – ähnlich wie ein Hersteller nach dem Produkthaftungsgesetz.
III. Haftungsgrundlagen nach deutschem Recht
- § 823 Abs. 1 BGB – Verletzung absoluter Rechte
→ Haftung bei Eingriffen in Eigentum oder Vermögen durch fehlerhafte Ausführung. - § 823 Abs. 2 BGB i. V. m. § 263 StGB
→ Betrugsnahe Haftung bei Täuschung über Funktionsfähigkeit oder Sicherheit. - § 280 Abs. 1 BGB
→ Vertragliche Haftung bei Verletzung von Prüf- und Sorgfaltspflichten. - ProdHaftG §§ 1 ff.
→ Gefährdungshaftung für fehlerhafte Software als Produkt.
Die Anspruchsgrundlagen überlagern sich:
Während § 823 BGB Verschulden verlangt, haftet der Hersteller nach ProdHaftG verschuldensunabhängig, sobald ein Produkt mangelhaft ist.
IV. Haftungskette im DeFi-Ökosystem
1. Entwickler
Sie sind „Hersteller“ des Codes.
Fehlerhafte Programmierung, mangelnde Dokumentation oder fehlende Sicherheitsprüfung begründen Organisationsverschulden.
Ein Entwickler muss den Stand der Technik kennen – etwa bekannte Reentrancy-Lücken – und entsprechende Schutzmaßnahmen implementieren.
2. Plattformbetreiber
Betreiber, die fremden Code einbinden, haften für Auswahl- und Überwachungspflichten.
Wer ungeprüfte Open-Source-Bausteine übernimmt, haftet wie ein Importeur (§ 4 Abs. 3 ProdHaftG).
3. Auditoren
Ein Sicherheitsaudit ist kein bloß technischer Service, sondern ein vertraglich geschuldeter Sorgfaltsstandard (§ 241 Abs. 2 BGB).
Fehlerhafte Audit-Reports können zu Regressansprüchen führen.
4. DAO-Mitglieder
Bei dezentralen Organisationen (DAOs) stellt sich die Frage nach der Organhaftung.
Wer Governance-Token nutzt, um Entscheidungen über Deployments zu treffen, kann als faktischer Geschäftsführer haften (§ 43 GmbHG analog).
V. Der Audit als rechtlicher Sicherheitsgurt
Audits sind heute der entscheidende Haftungsanker.
Sie schaffen einen objektiven Nachweis, dass der Code dem Stand der Technik entsprach.
In Haftungsprozessen fungieren sie als Entlastungsbeweis.
Fehlt ein Audit, vermutet die Rechtsprechung (analog § 823 BGB), dass ein Organisationsverschulden vorliegt.
Ein Audit-Protokoll sollte enthalten:
- Prüfer-Identität und Qualifikation,
- Methodik (manuelle / automatisierte Tests),
- dokumentierte Findings und Fixes,
- Hash-Referenz des geprüften Codes.
Nur so kann im Streitfall bewiesen werden, dass der geprüfte Code identisch mit dem veröffentlichten ist.

VI. Vertragliche Haftungsbegrenzung
Haftungsausschlüsse in Smart-Contract-Projekten sind juristisch heikel.
Klauseln wie „Use at your own risk“ oder „Code is law“ schützen kaum.
Nach § 309 Nr. 7 BGB ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit nicht abdingbar.
Auch AGB, die nur in Whitepapern versteckt sind, gelten nicht als wirksam einbezogen (§ 305 Abs. 2 BGB).
Empfohlen wird daher:
- Transparente Nutzungsbedingungen in verständlicher Sprache,
- klare Risikoaufklärung über mögliche Bugs,
- Zustimmung durch aktive Handlung (z. B. Checkbox).
So entsteht echte Rechtssicherheit, ohne den Nutzer zu täuschen.
VII. Kausalität und Beweislast
In der Praxis entscheidet oft die Frage, ob der Schaden durch den Code oder durch externe Manipulation entstanden ist.
Der Geschädigte muss die Kausalität beweisen; der Entwickler kann sich entlasten, wenn er Audit- und Testnachweise vorlegt.
Gerichte orientieren sich an der Produkthaftungslogik:
Je komplexer der Code, desto höher der Prüfungsmaßstab.
Fehler, die bei einem einfachen Unit-Test erkennbar gewesen wären, gelten als grob fahrlässig.
VIII. Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht
Smart-Contract-Projekte operieren global.
Juristisch gilt:
- Gerichtsstand: Ort des Schadenseintritts (Art. 7 Nr. 2 EuGVVO).
- Recht: Ort, an dem der Schaden eingetreten ist (Art. 4 Rom-II-VO).
Damit können deutsche Gerichte zuständig sein, wenn deutsche Anleger betroffen sind – auch bei Plattformen in Asien oder den USA.
Die zunehmende Zahl von Urteilen deutscher Landgerichte zu „Crypto-Asset-Verlusten“ zeigt:
Internationale Dezentralität schützt nicht vor nationaler Haftung.
IX. Praxisfälle und gerichtliche Tendenzen
- Reentrancy-Exploit („Wiederaufruf-Fehler“)
– Gerichte werten fehlende Schutzmaßnahmen als Organisationsverschulden. - Oracle-Manipulation
– Fehlerhafte Preisfeeds begründen Haftung des Plattformbetreibers wegen fehlerhafter Datenbasis (§ 823 Abs. 2 BGB i. V. m. § 263 StGB). - Verlorene Private Keys nach Smart-Contract-Upgrade
– Hier greift § 280 BGB: Vertragsverletzung durch unzureichende Sorgfalt beim Update-Prozess.
In allen Fällen gilt: Die technische Ebene wird rechtlich durch die Sorgfaltspflicht ersetzt.
X. Haftungsabwehr und Versicherungsdeckung
Für Entwickler und Betreiber empfiehlt sich eine Cyber- oder Tech-Liability-Versicherung.
Sie deckt typische Risiken wie
- fehlerhafte Programmierung,
- Datenverlust,
- Haftpflichtansprüche Dritter.
Ein Anwalt prüft, ob die Police auch Smart-Contracts und Blockchain-Anwendungen umfasst – viele Versicherer schließen diese noch aus.
Wer eine Police ohne Blockchain-Klausel abschließt, steht im Ernstfall ohne Deckung da.
XI. Regress und Innenhaftung
Im Projektverbund haften mehrere Beteiligte.
Nach § 426 BGB besteht ein interner Ausgleichsanspruch zwischen Entwickler, Betreiber und Auditor.
Die Rechtsprechung tendiert dazu, Verantwortung anteilig zu verteilen – ähnlich wie bei Bauprojekten:
50 % Betreiber (fehlende Kontrolle), 30 % Entwickler, 20 % Prüfer.
Deshalb ist die Vertragsgestaltung entscheidend, um klare Regressketten festzulegen.
XII. Rolle des Anwalts in der Projektpraxis
Ein spezialisierter Anwalt begleitet DeFi-Projekte schon vor dem Deployment:
- Audit-Pflichten rechtlich prüfen,
- Haftungsklauseln entwerfen,
- Nutzerinformationen DSGVO-konform gestalten,
- Internationale Zulässigkeit und BaFin-Einstufung klären.
In der Krise übernimmt er die Koordination zwischen Entwicklern, Investoren und Ermittlungsbehörden, verfasst Haftungsgutachten und vertritt Mandanten in Zivilverfahren.
XIII. Beispiel aus der Kanzleipraxis
Ein deutscher DeFi-Anbieter veröffentlicht einen automatisierten Kredit-Smart-Contract.
Ein Sicherheitsfehler erlaubt es, Kredite ohne Sicherheit abzurufen.
Der Schaden: 14 Mio. €.
Der Betreiber argumentiert, der Fehler sei im Open-Source-Code eines Dritten enthalten gewesen.
Das Gericht sieht dies anders: Durch Integration in das eigene System wird der Betreiber zum Mit-Hersteller.
Er haftet gesamtschuldnerisch mit dem Entwickler (§ 421 BGB).
Das Urteil zeigt: Dezentralität entbindet nicht von Verantwortung.
XIV. Prävention – Haftung durch Governance vermeiden
Die beste Verteidigung ist Compliance:
- Einführung eines internen Risk-Boards,
- standardisierte Code-Reviews,
- Versions-Kontrolle auf GitHub mit Audit-Signaturen,
- sofortige Offenlegung von Sicherheitsvorfällen („responsible disclosure“).
Wer diese Prozesse dokumentiert, schafft eine Beweislinie, die Haftung im Ernstfall entscheidend reduziert.
XV. Zukunftsperspektive – Haftung im Zeitalter der KI-Code-Generierung
Immer mehr Smart Contracts werden durch KI-Tools generiert.
Doch wer haftet, wenn die KI fehlerhaften Code erstellt?
Nach aktueller Dogmatik bleibt der Mensch Verantwortlicher (§ 831 BGB analog).
Der Entwickler muss die Ergebnisse prüfen, bevor sie deployed werden.
Auch hier wird sich eine „Aufsichtspflicht über Algorithmen“ etablieren – ein neues Berufsfeld für Kanzleien mit Legal-Tech-Schwerpunkt.

XVI. Fazit – Verantwortung ist nicht dezentralisierbar
Smart Contracts schaffen Transparenz und Effizienz, aber sie heben die Haftung nicht auf.
Wer Code veröffentlicht, schafft Vertrauen – und trägt damit Verantwortung.
Das deutsche Haftungsrecht bietet klare Strukturen, um Geschädigte zu schützen und Entwickler zu verpflichten.
Für Juristen bedeutet das: Die Zukunft des Zivilrechts liegt im Code, aber das Recht bleibt menschlich.
Call-to-Action
Kostenloses Beratungsgespräch:
Ihr DeFi-Projekt braucht rechtliche Sicherheit oder Sie wurden durch einen Smart-Contract-Fehler geschädigt?
Kontaktieren Sie Rechtsanwalt Max Nikolas Mischa Hortmann unter 📞 0160 9955 5525 oder über
hortmannlaw.com/contact
Dieser Artikel beleuchtet Parallelen zwischen staatlicher Kontrolle, Schattenwirtschaft und digitaler Finanzregulierung – vom Bereich der Sexarbeit bis zur Krypto-Compliance.
Fehlende Regulierung der Sexarbeit – wie Love-Scamming, Sugar-Daddy-Plattformen und digitale Prostitution dem Staat entgleiten
Fehlende Regulierung der Sexarbeit – wie Love-Scamming, Sugar-Daddy-Plattformen und digitale Prostitution dem Staat entgleiten
Verwandte Aufsätze – Themenblock „Finanzaufsicht & Ermittlung“
Diese Beiträge vertiefen die juristischen, forensischen und regulatorischen Aspekte von Geldwäsche, Ermittlungsverfahren und DeFi-Compliance. Sie zeigen, wie Aufsicht, Kanzlei und Detektei in der Praxis zusammenarbeiten, um digitale Finanzkriminalität aufzuklären und zu verhindern.
- On-Chain-Ermittlungen bei Krypto-Betrug – wie Anwalt und Forensik DeFi-Hacks aufklären
https://www.hortmannlaw.com/articles/on-chain-ermittlungen-krypto-betrug-anwalt
- Geldwäsche & DeFi – rechtliche Pflichten und FIU-Meldungen
https://www.hortmannlaw.com/articles/geldwaesche-defi-krypto-betrug-anwalt - Smart-Contract-Haftung – Verantwortung bei Fehlern im Code
https://www.hortmannlaw.com/articles/smart-contract-haftung-krypto-betrug-anwalt - Steuerliche Behandlung von DeFi-Verlusten nach Krypto-Betrug – Anwalt erklärt Nachweis und Anerkennung
https://www.hortmannlaw.com/articles/steuerliche-behandlung-defi-verluste-krypto-betrug-anwalt - Plattform-Verantwortung bei Krypto-Betrug – Anwalt erklärt Haftung von DeFi-Betreibern und DAOs
https://www.hortmannlaw.com/articles/plattform-verantwortung-defi-krypto-betrug-anwalt - DeFi-Compliance und Datenschutz – Anwalt über DSGVO-Risiken bei Krypto-Betrug
https://www.hortmannlaw.com/articles/defi-compliance-datenschutz-krypto-betrug-anwalt - Incident Response nach DeFi-Hack – rechtliche Meldepflichten und Kommunikationsstrategien
https://www.hortmannlaw.com/articles/incident-response-defi-hack-krypto-betrug-anwalt - Internationale Zuständigkeit bei DeFi-Betrug – Anwalt erklärt Gerichtsverfahren und Durchsetzung
https://www.hortmannlaw.com/articles/internationale-zustaendigkeit-defi-krypto-betrug-anwalt - Krypto-Betrug nachweisen – anwaltliche Forensik-Checkliste für DeFi-Opfer
https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-nachweisen-anwalt-checkliste - Prävention – DeFi-Risiken erkennen – Anwalt warnt vor neuen Formen des Krypto-Betrugs
https://www.hortmannlaw.com/articles/defi-risiken-erkennen-krypto-betrug-anwalt - Zukunft des DeFi-Rechts – MiCA und DAC8 – Anwalt erklärt neue Transparenz- und Haftungsregeln
https://www.hortmannlaw.com/articles/zukunft-defi-recht-mica-dac8-krypto-betrug-anwalt
Weiteres:
Diese Beiträge zeigen, wie anwaltliche Strategie und operative Detektivarbeit bei Krypto-Betrug, Love Scam und Online-Täuschung zusammenwirken. Sie erklären, wie juristische und forensische Beweissicherung kombiniert wird, um Täterstrukturen sichtbar zu machen und Mandanten zu schützen.
- Detektei und Anwalt – Love Scam und digitale Täuschung gemeinsam aufklären
https://www.hortmannlaw.com/articles/detektei-anwalt-love-scam-zusammenarbeit - Krypto- und Anlagebetrug – wie Anwalt und Detektiv gemeinsam Täter überführen
https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-anlagebetrug-anwalt-detektiv-taeterueberfuehrung - Beweissicherung bei Love Scam und Krypto-Betrug – Zusammenarbeit zwischen Detektei und Kanzlei
https://www.hortmannlaw.com/articles/beweissicherung-love-scam-krypto-detektei-kanzlei - Mandantenschutz durch Kanzlei-Detektei-Kooperation bei Betrugsmaschen
https://www.hortmannlaw.com/articles/mandantenschutz-kanzlei-detektei-kooperation-betrugsmaschen
Auch lesenwert:
- Krypto Betrug melden – Anwalt hilft Opfern bei Bitcoin- und Ethereum-Exchanges
https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-melden-opfer-anwalt - Krypto Betrug über DEX, Bridges & Mixer – Anwalt schützt Bitcoin- und Ethereum-Opfer
https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-dex-bridges-mixer-opfer-anwalt - Krypto Betrug: Beweissicherung und Spurensuche auf der Blockchain
https://www.hortmannlaw.com/articles/beweissicherung-krypto-betrug - Krypto Betrug: Crypto.com wusste Bescheid – Pflichtverletzung bei Scam-Flags und Untätigkeit
https://www.hortmannlaw.com/articles/crypto-com-scam-flags-pflichtverletzung - Krypto Betrug: Custodial vs. Non-Custodial Wallets – Haftung im Vergleich - Anwalt erklärt
https://www.hortmannlaw.com/articles/custodial-non-custodial-wallet-haftung - Krypto Betrug: Datenlecks auf Plattformen – Wenn Sicherheit zum Risiko wird
https://www.hortmannlaw.com/articles/datenlecks-krypto-betrug - Krypto Betrug: Finanzaufsicht und Haftung – Warum die BaFin oft zu spät reagiert
https://www.hortmannlaw.com/articles/bafin-haftung-krypto-betrug - Krypto Betrug: Internationale Geldwäscheketten – Wie Täter Spuren verschleiern
https://www.hortmannlaw.com/articles/geldwaescheketten-krypto-betrug - Krypto Betrug: Rückbuchung nach Krypto-Transfer – Gibt es eine rechtliche Chance?
https://www.hortmannlaw.com/articles/rueckbuchung-krypto-transfer - Krypto Betrug: Schadensersatzklagen gegen ausländische Plattformen
https://www.hortmannlaw.com/articles/schadensersatz-ausland-krypto - Krypto Betrug: Strafanzeige gegen Plattformen (z.B. Crypto.com) – Chancen und Grenzen der Strafverfolgung
https://www.hortmannlaw.com/articles/strafanzeige-krypto-plattform - Krypto-Address-Hijacking – Falsche Wallet-Adressen und Blockchain-Beweisführung
https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-address-hijacking-falsche-wallet-adressen - Krypto-Betrug bei Crypto.com – Die Illusion der Kontrolle in den AGB
https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-crypto-com-illusion-kontrolle - Krypto-Betrug und Rückzahlung – steuerliche Behandlung von Recovery-Geldern
https://www.hortmannlaw.com/articles/steuerliche-behandlung-recovery-gelder - Krypto-Betrug via WhatsApp, Telegram & Co.
Das könnte Sie auch interessieren
Entdecken Sie weitere Beiträge zu aktuellen Themen rund um Digitalrecht, Cybercrime, Datenschutz, KI und Steuerrecht. Unsere verwandten Artikel geben Ihnen zusätzliche Einblicke und vertiefende Analysen.

.jpg)
Haftung der Bank bei Krypto-Betrug & Anlagebetrug – Anwalt Leitfaden 2026 zur Bankenklage
Wann haftet eine Bank trotz autorisierter Überweisung? Der Leitfaden 2026 erklärt die dogmatischen Schwellen für Bankenklagen nach Krypto-, Anlage- und Love-Scam.

.jpg)
BitBox, MetaMask, Trust Wallet: Krypto-Betrug ohne Hack und ohne Phishing
Anlagebetrug mit BitBox, MetaMask und Trust Wallet: Kein Hack, keine Phishing-Masche – sondern täuschungsbedingte Eigenüberweisungen. Jetzt einordnen.

.jpg)
Krypto Betrug Geld zurück? Binance, Crypto.com, Coinbase – Chancen, Freeze, rechtliche Schritte
Nach einem Krypto-Betrug ist das Vermögen nicht automatisch verloren. Der Beitrag erklärt, wann Börsen wie Binance, Crypto.com oder Coinbase eingebunden werden können, welche Sicherungsmaßnahmen realistisch sind und welche Versprechen unseriös sind.
Suchen Sie dringend diskrete, juristische Unterstüzung?
Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter – schildern Sie uns Ihr Anliegen und wir finden gemeinsam eine Lösung.